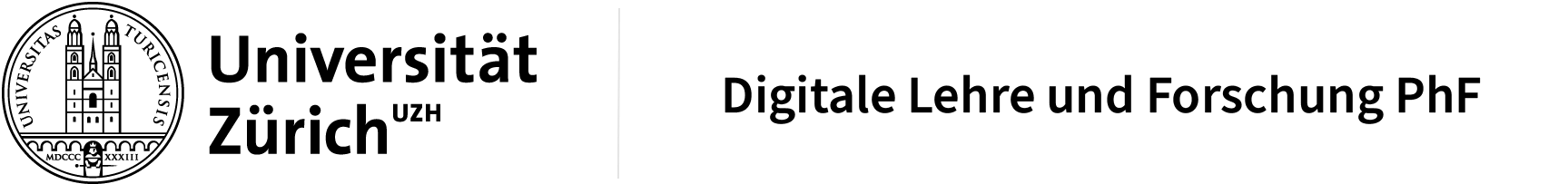Veränderung der Publikationsformen durch E-Books, Online-Zeitschriften und Open Access, Intensivierung und Globalisierung der Kommunikation durch Social Media-Instrumente, Zunahme kollaborativer Arbeitsformen durch die Technologien des Web 2.0 wie Blogs und Wikis, Zunahme der Interaktivität durch E-Learning – die diskutierten und manifesten Auswirkungen der Internet-Technologie und des World Wide Web auf die akademische Welt in Forschung und Lehre sind so vielfältig und wie herausfordernd.
Meist bleibt aber unerwähnt, dass auch eines der traditionellsten Rituale der wissenschaftlichen Welt durch die Neuen Medien in Bewegung gerät: die wissenschaftliche Tagung. Inspiriert durch den Geist von Web 2.0 und Social Media, beginnen sog. „Camps“ als neue Konferenz-Form auch die Welt der Wissenschaften zu erobern. Diese Entwicklung birgt das Potenzial in sich, die paradoxerweise an den Rand gedrängte Interaktivität und Kommunikation wieder ins Zentrum wissenschaftlicher Tagungen zu rücken.
Der Gang zu Tagungen und Konferenzen gehört zu den Haupttätigkeiten eines jeden Wissenschaftlers. Solche Besuche sind für die wissenschaftliche Karrierebildung genauso zentral wie das Publizieren in den einschlägigen Zeitschriften – wer Karriere machen will, muss auf möglichst vielen Tagungen Präsenz markieren. Diese sind zudem stark hierarchisch strukturiert: In manchen Wissenschaftsbereichen gleichen einige davon Initiationsritualen, durch welche junge aufstrebende Wissenschaftler von den etablierten Cracks geschleust werden, um sie auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Manche dieser Tagungen haben eine Tradition von weit über 100 Jahren, viele davon wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts im Zuge der Etablierung der modernen Wissenschaftswelt ins Leben gerufen und bestehen bis heute in kaum veränderter Form.
Das Paradoxe daran ist, dass infolge dieser rituellen Handlungen der kommunikative Aspekt, der doch im Vordergrund stehen sollte, ins Abseits gedrängt wird. Einerseits ist die Tagung aufgrund der hierarchischen Struktur von starker Zensur geprägt – niemand will sich durch unbedachte Äusserungen oder durch ein aufmüpfiges Referat die Karrierechancen vermiesen. Die Tagungen bestehen andererseits in der Regel aus einer Reihe von mehr oder minder lückenlos aneinandergereihten Referaten. Für Diskussion bleibt in der Regel wenig bis gar keine Zeit bzw. muss diese in die Kaffeepause verlegt werden. Last but not least handelt es sich bei den Referatsgrundlagen meist auch noch um einen Fliesstext, der für den geplanten Tagungsband geschrieben und nicht für ein mündliches Referat gedacht war. Somit bestehen viele dieser Event aus einer Reihe von für alle Beteiligten ermüdenden Selbstdarstellungsritualen: „Ein Vortrag wird doch nicht für die da im Plenum gehalten! Er ist ein selbstreferenzieller Akt der Wissenschaftsgemeinde, der nur auf sich selbst verweist und alles sein darf – nur nicht lebendig und unterhaltsam. Also lesen, was das Zeug hält, viergliedrige Satzungeheuer, mit Einschüben, Semikola und Parenthesen“, ärgert sich z.B. der bekannte Münsteraner Rechtswissenschaftler Thomas Hoeren in Spiegel-Online.
Seit einigen Jahren nun breiten sich aber neue Formen wissenschaftlicher Tagungen aus, die stark vom Demokratisierungsgedanken des Web 2.0 geprägt sind. Interessanterweise fand die erste solche Tagung – ein sog. BarCamp – 2004 statt, also exakt im selben Jahr, in welchem Tim O’Reillys geflügeltes Wort des Web 2.0 weltweit Verbreitung fand. Ursprünglich stammt die Camp-Idee aus Kalifornien aus dem Bereich der neuesten Trends in der Informationstechnologie (Web-Applikationen, open source-Technologien, social software und offene Dateiformate). Mit der Charakterisierung als „user-generated conference“ wird erstens diese Verbindung mit der Idee des Web 2.0 explizit gemacht. Der ebenfalls zur Charakterisierung solcher Tagungsformen eingesetzte Begriff der „Unconference“ macht zweitens klar, von was sich die Erfinder der Camp-Idee absetzen wollen: von der klassischen starr strukturierten, hierarchischen Tagungsform in der Form aneinandergereihter Referate hin zu einer offenen, spontanen, kreativen Diskussion unter Gleichberechtigten zu Themen, die von einer Mehrheit der TeilnehmerInnen als wichtig erachtet wurden .
Un-Conferences zeichnen sich dadurch aus, dass jeder, der mitmachen will, Vorschläge für sog. „Sessions“ einbringen kann, entweder im Vorfeld oder direkt an der Tagung. Ablauf und Inhalte werden von den TeilnehmerInnen hauptsächlich im Tagungsverlauf selbst entwickelt. Grundsätzlich steht die Diskussion im Vordergrund; zentral dabei ist auch, dass in den Sessions alle TeilnehmerInnen von Beginn weg aktiv teilnehmen und nicht zur passiven Rezeption gezwungen sind.
Die Camp-Idee hat in den letzten Jahren weltweit in allen Bereichen der Gesellschaft starke Verbreitung gefunden, auch in der Wissenschaft; inzwischen gib es unzählige davon. Nur schon im deutschsprachigen Raum – in einer Zusammenstellung werden für das Jahr 2013 29 verschiedene Camps aufgezählt.
An dieser Stelle sei hier nur auf zwei solcher Camp-Formen in der Wissenschaft verwiesen, an denen ich selber teilgenommen habe. Beide werden von Gruppierungen durchgeführt, die eine besondere Affinität zu Informations- und Kommunikationstechnologien aufweisen: das EduCamp von Medien- und Kommunikationswissenschaftlern und das THATCamp aus dem Bereich der Digital Humanities. EduCamps werden weltweit seit 2007 durchgeführt, im deutschsprachigen Raum seit 2008. Das THATCamp (The Humanities and Technology Camp) ist eine Initiative des Center for History and New Media der George-Mason-University in Virgina (USA) und existiert seit 2008. Unterdessen finden THATCamps überall auf der Welt statt (http://thatcamp.org). Auch diese Tagungsform ist eine Un-Conference wie das EduCamp, doch zusätzlich werden sog. BootSessions angeboten, vorab festgelegte thematische Slots mit geladenen Gästen.
Beide Camp-Formen sind vor und während der Tagung stark durch den Einsatz von Web 2.0-Technologien und Social Meda geprägt: Vor einem EduCamp etwa wird zum Zwecke des Community-Building eine Kommunikationsplattform eingesetzt (http://educamp.mixxt.de). Dort können Details wie Anreise oder Unterkunft geklärt werden. Die Plattform bietet auch die Möglichkeit, Themenvorschläge für Sessions zu posten und zu prüfen, wie diese von der Community im Vorfeld aufgenommen werden. Während der Tagung kommen Social Media-Instrumente wie Twitter zum Einsatz. Der Einsatz von Twitter an Tagungen ist umstritten, persönlich habe ich ihn als bereichernd erlebt: da man nie an allen Sessions gleichzeitig teilnehmen kann, geben Tweets die Möglichkeit mitzuerleben bzw. nachzuvollziehen, was in anderen Sessions geschieht und sie ermöglichen es gleichzeitig auch, mit den Urherbern der Tweets, falls gewünscht, in Kontakt zu treten. Auch und besonders dann, wenn man selber nicht an der Konferenz teilnehmen kann. Als sehr sinnvoll und bereichernd kann auch der Einsatz von kollaborativen Online-Schreibwerkzeugen (z.B. Piratepad.net) zu Dokumentationszwecken betrachtet werden. Insgesamt ist ein solches Camp ein kommunikativ-kreatives Ereignis, welches sehr motivierend wirkt und in dem man schnell mit anderen Teilnehmern in eine aktive Diskussion tritt; ihr akademischer Grad spielt dabei keine Rolle. Amanda French, die regionale THATCamp-Koordinatorin am CHNM, beschreibt die Erfahrung einer Unkonferenz mit einem „höheren Grad von intellektuellem Engagement verglichen mit einer traditionellen wissenschaftlichen Konferenz“.
Zu beobachten ist, dass im deutschsprachigen Raum die Mehrzahl der Besucher Studenten oder Angehörige des Mittelbaus sind. Professoren und Professorinnen, v.a. von den klassischen Universitäten sind kaum oder gar nicht anzutreffen. Der traditionelle Wissenschaftsbetrieb wurden von den neuen Tagungsformen noch nicht erfasst – das liegt wohl nicht zuletzt im expliziten Versuch der Camps, hierarchische Strukturen des Wissenschaftsbetriebes aufzubrechen. In diesem Versuch erinnern sie an die universitären Teach-Ins der 1960er Jahre. Beide Aktionsformen verfolgen beinahe identische Zielsetzungen vor dem explizit formulierten ideologischen Hintergrund des Wunsches nach Demokratisierung und grösserer Partizipation.