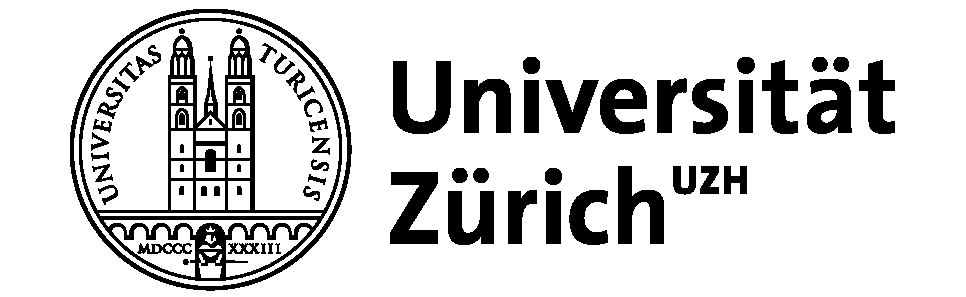Bettina Gockel
«[…] das Vortreffliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. […] Ich schwätzte, anstatt zu erzählen.»
Johann Wolfgang von Goethe,
Der Sammler und die Seinigen, Erster Brief
Bildgeschützte Geschichtsnarrative
«Ich hatte keine Vorbilder», antwortete Franz Zelger (* 17. März 1941) im Winter 2020 auf Nachfrage. Zelger ist der Urenkel des Landschaftsmalers Jakob Josef Zelger (1812–1885). Er stammt aus dem katholischen Luzern, wie nicht wenige der Kunsthistoriker in der Geschichte des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich. Der Freigeist Zelger beruft sich jedoch nicht auf derartige Genealogien, sondern beansprucht – das sei vorweggenommen – die Haltung des innovativen Solitärs. Das Gespräch sollte die Geschichte des anfangs der 1980er-Jahre neu eingerichteten Lehrstuhls für Geschichte der bildenden Kunst reflektieren. Zuvor hatte sich Zelger zu meinem Vortrag in der von Carola Jäggi konzipierten Reihe «150 Jahre Kunstgeschichte an der Universität Zürich» digital zugeschaltet, ein Vortrag, der im Hinblick auf Zelger mehr eine kritische Analyse als eine Hommage sein sollte – und ihn, wie ich mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis nehmen durfte – überzeugt hatte. Jubiläen haben es an sich, dass der viel beschworene Geist des Kritischen als Nukleus wissenschaftlichen Fortschritts plötzlich versickert zugunsten des strahlenden Erfolgsnarrativs, gerne auch des Genie-Entwurfs, also der Hagiographie. Das steckt einem in den Knochen, wie meine Reaktion der ‹Erleichterung› zeigt; hier das kritische Bewusstsein, dort dann doch die Konfrontation mit dem sehr lebendigen ‹Vorgänger›, über dessen Wirken ich zu dessen Lebzeiten reden und schreiben sollte – Musils Nachlass zu Lebzeiten kommt einem da in den Sinn, ein hoch angelegter und riskanter Anspruch des Unvollendeten, denn ‹Nachlass zu Lebzeiten› wurde ein geflügeltes Wort, etwas, das man sich selbst zu Lebzeiten klarmachen muss, was wiederum bedeutet: Wie bedeutend bin ich?
Was steckt da in den ‹Knochen›, um beim Bild der Verkörperung zu bleiben? Sicher die wahrnehmungspsychologische Stereotypenbildung, ein inneres Muster, das überhaupt erst zur Hagiographie führt.[1] Der männliche Professor und Gelehrte ist eine kaum analysierte Figur, mit der sich sicher heute viele männliche Kollegen nicht mehr identifizieren. Aber es geht dabei keineswegs um die eigene individuelle Identität, oder jedenfalls nicht primär, sondern um die gesellschaftliche Wahrnehmung, in der die Stereotype fest verankert ist, so sehr, dass … – aber das wäre eine andere Geschichte, die Geschichte darüber, wie es sich so lebt als Professorin, mal als exklusive Galionsfigur und als «role model» gesehen, wenn der Kontext stimmt, aber meist mit der Überraschung von Menschen konfrontiert, die ungläubig starrend oder erfreut oder erstaunt oder verunsichert Begriff und Bild nicht recht miteinander verknüpfen können: Professor(in) und das Bild davon.[2] Die Inkommensurabilität des Bildes und des Begriffs aufgrund der wie in Stein eingemeisselten Stereotypen, welche die Welt ordnen. Es geht eben nicht um harmlose Bilder, sondern um Visualisierungen von Formeln und den Kraftakt, diese zu verschieben, zu bearbeiten, zu verändern, zu erweitern. Anstatt die «Pathosformeln» Aby Warburgs zu perpetuieren, könnte es darum gehen, deren massive, paradigmatische Brechung und die Bevorzugung anderer, wichtigerer Bilder zu untersuchen und zu lancieren. Aber klar ist: Wir müssen auch die «Pathosformeln», also die Stereotypen, verstehen. Nur, wenn wir uns darauf konzentrieren und diese immer und immer wieder abbilden, reproduzieren – und das auch noch als kritisch denkende Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker –, dann ändert sich vielleicht etwas am visuellen Analphabetentum, aber nicht an der Stereotypenbildung. Ein wenig hat die Visualisierung von Zelger doch zu dieser ‹anderen›, zukünftigen, zu erträumenden diversen, inklusiven Geschichte beigetragen, wie ich zeigen möchte. War und ist er ein «Mann ohne Eigenschaften», eine Person, die sich einer eindeutigen Charakterisierung und Positionierung im beruflichen wie kulturellen und politischen System entzieht?
Leichtigkeit des Seins – Zeitlose Bilder
Zelger erscheint als eine schwer einzuschätzende, weil facettenreiche Persönlichkeit, die es schafft, unbekümmert wirkenden Humor mit einem scharfen kritischen Blick so zu verknüpfen, dass man sich schnell täuschen lässt – wie die ungezählten Studierenden, die geschockt durch ‹schlechte› Noten für Lizentiatsarbeiten oder wegen der Ablehnung einer Doktorarbeit eine nur vermeintlich andere Seite des so umgänglich und gesellig wirkenden Wissenschaftlers kennenlernen mussten. Ziel dieses Essays ist es, das Facettenreiche dieser wissenschaftlichen «persona» darzulegen, in den historischen Kontext des Lehrstuhls zu stellen und damit auch ein Bild des Lehrstuhls und seiner Strukturen, Kontinuitäten und Weiterentwicklungen zu vermitteln. Der Begriff «persona» ist hier – neben dem des «Stereotyps» – bedeutsam, denn darin verweben sich bekanntlich Anekdoten und biographische Erzählungen zu Masken und Maskeraden, die zu einem authentisch wirkenden und für die Historizität wirksamen Konglomerat verschmelzen und sich eben wegen dieses seinerseits historischen Prozesses des Einschmelzens der diversen Elemente nicht völlig auseinandernehmen lassen wie bei einem Puzzle. Wir werden sehen, dass eine Fotografie, die der berühmte Schweizer Fotograf René Burri (1933–2014) von Zelger in seinem Büro machte, genau zu dieser konzeptionell diffusen, aber umso wirksameren Funktionalität der Herstellung einer «persona» beitrug, ohne die «Stereotype» rezeptionsästhetisch gänzlich beiseite lassen zu können (selbst wenn das gewollt gewesen war oder wäre).
Nach meinem Vortrag am 11. November 2020 im Institutskolloquium zum 150-jährigen Jubiläum des Fachs Kunstgeschichte an der Universität Zürich klingelte also gleich das Telefon. Natürlich, pandemiebedingt, in meinem privaten Büro zuhause. Etwas überrascht war ich schon, wie auch über die digitale Zuschaltung, die nicht angekündigt war, aber genau das würde Franz Zelger jetzt etwas lächerlich machen, nach dem Motto: «Was, meinst Du das kann ich nicht mehr als knapp 80-Jähriger?» Und so verwickelte mich mein ‹Vorgänger› quicklebendig in ein Gespräch, das mit dem Plan, sich trotz Pandemie zeitnah zu treffen, endete. Ziel war, sich über das Fotoporträt von Burri, das zu seiner Amtszeit das Institutsbüro zierte und in der Festschrift zu seinem 60. Geburtstag als Frontispiz abgebildet ist,[3] auszutauschen und ein Buchprojekt anzudenken, das Interviews mit den vielen kunsthistorischen Schüler:innen Zelgers enthalten soll und sich in Planung befindet.[4]
Denn, das sei auch vorweggenommen: Die Schweizer Museums- und Galerieszene ist von Zelgers Lehre und Forschung an der Universität Zürich, aber vor allem von seinem «Ikigai» geprägt, welches – so wie ich es verstehe – lautet: Kunstgeschichte ist eine offene Art, auf Kunstwerke zuzugehen, diese durch Sprache nachzuempfinden und so auch ein Stückweit erst erstehen zu lassen, vor den Augen nicht nur von Lesenden, sondern vor den Augen von Menschen im Museum, die nur schwer Zugang zu dem erlangen, was sie vor sich haben.[5] Das Aufleben von materiellen Kunstwerken in der Imagination von Individuen und Gesellschaften – durch Sprache, Sprechen, Schreiben – ist eine der ganz grossen Aufgaben von Kunsthistoriker:innen. – Das besagte persönliche Treffen fand dann eine Woche später in einem geradezu kunsthistorisch anmutenden Besprechungsraum des Züricher Hotels Helvetia statt, in dem zu meiner Überraschung eine kleine, aber feine kunsthistorische Büchersammlung untergebracht ist, die aus den Beständen der Privatbibliothek von Zelger stammt. Schlendert man an den Büchern entlang, fällt die Bandbreite der Themen über alle Medien und Epochen auf, selbst ein 2018 erschienenes Buch von Nele Dechmann über die Villenarchitektur an der Costa Smeralda seit den 1960er-Jahren findet sich darunter – ein durchaus randständiges Thema, das allerdings bei genauerem Hinsehen transkontinental, interdisziplinär, ökonomisch und geographisch geprägt ist, – was könnte aktueller sein? Man möchte als Ordinaria gleich eine Exkursion für Studierende konzipieren. Malerei, Skulptur, Architektur, Fotografie – eingrenzen liess sich Zelger nie – bis heute nicht, obwohl er als Spezialist für die Schweizer und europäische Historienmalerei des 19. Jahrhunderts gilt.[6]
Genau deshalb war er prädestiniert für eine neue Professur am Kunsthistorischen Seminar der Universität Zürich, die dort frischen Wind in Lehre und Forschung bringen sollte. 2008 wurde dieser Professur die drei Jahre zuvor gegründete Lehr- und Forschungsstelle für Theorie und Geschichte der Fotografie angegliedert, wodurch das mediale Spektrum, das der Lehrstuhl von Anfang an behandeln sollte, institutionalisiert worden ist.
Die Geschichte des Lehrstuhls zu erzählen, ergibt jedoch keine besonderen Erkenntniswerte, handelt es sich doch eher um eine Verkörperung durch den damaligen ersten Inhaber, auf den ich als erste Frau seit der Etablierung des Fachs Kunstgeschichte im Jahr 1870 an der Universität Zürich im Februar 2008 gefolgt bin.[7] Die dezidierte Geschichts- oder Traditionslosigkeit, die Zelgers selbstbewussten, aber immer auch leise ironisch und provozierend vorgetragenen Worte vermitteln (sollten), führte zur Neuheit und Innovation, die mit der Einrichtung seines Lehrstuhls einhergehen sollte. Ganz ähnlich, wie der untergründig doch als Vorbild fungierende Werner Hofmann – durchaus häufig zitiert von Zelger und als Freund bezeichnet –, der es an der Hamburger Kunsthalle so intensiv wie niemand vor ihm verstand, die Brücke zwischen Museum und Universität zu schlagen, indem er forschungsorientierte Beziehungen und kollaborative Publikationen zum und mit dem Kunsthistorischen Seminar der Universität Hamburg aufbaute und pflegte, stand Zelger für eine Professur, die dezidiert den Bezug zum Museum herstellen sollte. Er als Museumsmann, als Konservator des Museums Oskar Reinhart am Stadtgraben, Winterthur, von 1975 bis 1983, initiierte eine für diesen Lehrstuhl bis heute lebendige Profilierung durch die Öffnung des universitären Elfenbeinturms hin zur öffentlichen Institution Museum. Also eine ‹Politik›, die Reinle und Maurer schon wollten in einer Zeit, als Stichworte wie lehrstuhlübergreifende Kollaboration noch ungebräuchlich waren. Was heute vielleicht nicht selbstverständlich, aber doch verbreitet ist (oder eher müsste man sagen, was eine Zeitlang nicht selbstverständlich war), nämlich Übungen für Studierende vor Originalen in Museen und Galerien und das Schreiben von Ausstellungskritiken, prägte Zelgers «teaching philosophy», zu der ausgedehnte und regelmässige Exkursionen gehörten. Die damals für einen Professor der Kunstgeschichte ebenfalls nicht selbstverständliche Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und grosse Bandbreite der kunsthistorischen Interessen, mit der Zelger die Denomination Geschichte der bildenden Kunst kongenial verkörperte, spiegelt sich in seinen zahlreichen und regelmässigen Ausstellungskritiken, die häufig kunsthistorisch weit ausholen, wie jüngst der Beitrag Ihre Väter hatten anderes mit ihnen im Sinn. Fede Galizia und ihre Kolleginnen waren die Frauenpower der italienischen Renaissance in der Neuen Zürcher Zeitung vom 28. August 2021, S. 37, zeigt.[8] Erst nach einer ebenso umfassenden wie sozialhistorisch genauen Darlegung der Leistungen von Künstlertöchtern von Artemisia Gentileschi über Marietta Robusti und Elisabetta Sirani kommt der Autor auf die erste monographische Ausstellung zu Fede Galizia zu sprechen und zeigt so prononciert, wie wenig wir über die Künstlerinnen um 1600 in Italien und Europa wissen. Die Ausstellung fand im Castello del Buonconsiglio in Trient statt.[9] Sie kann als Teil eines Paradigmenwechsels in der kunsthistorischen Frauenforschung verstanden werden, nämlich die Aufmerksamkeit auf die Erfolgsgeschichten von Künstlerinnen zu lenken, welche in den Narrativen des Fachs von männlichen Kunsthistorikern in einem Ausmass ausgeblendet wurden, das selbst heute noch verblüfft, weil das bedeutet, wie Linda Nochlin konstatierte, dass die Geschichte der Kunst schlicht mit faktischen Fehlern durchsetzt ist. Diese Postur des männlichen Kunsthistorikers, der sich allein männlichen Künstlern widmet, um ein prestigemässiges Joint Venture zu erreichen, folgte Zelger nicht. Auch das liess ihn – wiederum besonders für die damalige Zeit seiner Professur – innovativ und wohl auch mitunter unbequem im akademischen System erscheinen, worauf die Universität aber inklusiv reagierte anstatt die Postur des «enfant terrible», die Zelger nicht selten einnahm, zum Beispiel als äusserst bunt in Rosa, Gelb und Grün gekleideter Kollege, in das Stereotyp des akademischen Einzelgängers und ‹Kauzes› zu stecken.
Zelgers Beweglichkeit, was Posturen und Images betrifft, zeigte sich dann auch, als er, stets elegant mit Anzug und Krawatte gekleidet, als engagierter Dekan der Philosophischen Fakultät von 2002 bis 2004 agierte (zuvor von 2000 bis 2002 als Prodekan und von 1996 bis 2002 als Vorsteher des Kunsthistorischen Instituts) –, ohne von der Anekdote (oder Tatsache?) lassen zu können, dass er im akademischen Alltag die farbenfrohen Kleider seines Sohns auftrug. Das ist ein durchaus aufmüpfiges Spiel mit dem Stereotyp des männlichen Professors, das Zelger aber auch nicht ganz abstreifen konnte, sind Stereotype doch tief im Wahrnehmungsapparat unserer Gesellschaft verankert und werden sie doch visuell immer wieder, auch in diesem Buch, durch Professorenporträts und Professorenbüsten bestätigt. Welche Publikation zur Geschichte Kunsthistorischer Institute würde darauf verzichten? Und doch wäre das wahrscheinlich die einzig mögliche Geste, um das Wahrnehmungsmuster aufzulösen, vielleicht sogar dereinst zu ändern, indem etwas, das tief eingegraben ist, eine Zeitlang verschwindet, um die Erfolgsgeschichte der ‹Anderen› in den Gesichtskreis treten zu lassen. Entstünde so dann ein diverses, inklusives Bild des Fachs und seiner Geschichte? Womöglich. Auf diese Porträtproblematik scheint auch das bereits genannte Fotoporträt einzugehen, welches René Burri (1933–2014) im Rahmen einer kleinen Fotokampagne von Franz Zelger im März 2000 aufgenommen hat.
René Burri, Che Guevara und Franz Zelger
Was haben Franz Zelger und Che Guevara gemeinsam? Fotohistorisch lässt sich das leicht erklären, denn beide Fotografien, die des Revolutionärs und die des Professors, wurden von Burri geschossen Es gibt jedoch noch tiefer liegende Gemeinsamkeiten, die sich aber erst etwas später erschliessen werden.

Foto: © KEYSTONE/MAGNUM PHOTOS, Bildnummer/Bildquelle: 432954716.
Über die 1963 während eines Gesprächs aufgenommene Fotografie, die Che Guevara zeigt, hat Silvia Gonzáles einen innovativen Beitrag in der Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Zelger geschrieben.[10] Erstmals zeichnet sie nach, wie das Che-Foto zu einem Kultbild wurde. Burri konnte mit seinem Schweizer Pass problemlos nach Kuba reisen, um dort den Guerillakämpfer zu treffen, der mit seinen Anhängern im Kalten Krieg um ein autonomes Kuba kämpfte. Burri schoss ca. 150 Aufnahmen, aus denen dann eine grosse Bekanntheit erlangte und zum Markenzeichen von Burri selbst wurde. Diese Symbiose ging so weit, dass Burri sich 1997 im Fotoforum Luzern im Che-Look mit Zigarre ablichten liess. Als Burri drei Jahre später Zelger vor der Linse hatte, tat er dies als Star-Fotograf und trug allein schon damit zur Bedeutung des Bildes und zur Nobilitierung des Abgelichteten bei. (Abb. 1)
In der Fotografie ist Franz Zelger leicht aus der Mitte nach links gerückt; von seiner Kleidung sehen wir das helle Jackett, das weisse Hemd und eine auffällig, mit kleinen Quadraten gemusterte Krawatte. Der Kopf wird von rechts so beleuchtet, dass das weisse Haar sich von rechts über den Kopf nach links erhellt, wenn nicht sogar erstrahlt. Das dem Betrachter zugewandte Gesicht ist von dem direkten, offenen Blick, aber auch von den wie zum Gespräch geöffneten Lippen geprägt. Rechts im Hintergrund ist Meret Oppenheims Gemälde Das Auge der Mona Lisa von 1967 als Ausstellungsplakat zu sehen. In dem unscharf gestellten Hintergrund zieht das überdimensionale Auge die Blicke auf sich. Nimmt man noch das Kameraauge des Fotoapparats von Burri und das Auge des Fotografen hinzu, dann ist diese Fotografie ganz und gar vom Auge als Instrument des Sehens und der sehenden, blickenden Interaktion zwischen Menschen und Medien erfasst.
Meret Oppenheims Das Auge der Mona Lisa
Meret Oppenheim (1913–1985) nahm mit ihrem Gemälde ein surrealistisches Paradigma auf, nämlich die aneignende und konterkarierende Beschäftigung mit dem Meisterwerk und dem Mythos der Mona Lisa. Während ihre männlichen Künstlerkollegen das berühmte, geheimnisvolle Lächeln zum Schnurrbart umfunktionierten und damit den weiblichen Ruhm in einen männlichen umfunktionieren wollten, zoomt sich Oppenheim gleichsam an das wohl berühmteste Kunstwerk der Kunstgeschichte heran, indem sie das Auge der Porträtierten als eigentlich porträt- und ruhmeswürdig ausmacht. Man darf dieses Auge auch als eine Art Selbstporträt der Künstlerin verstehen, die mit ihrem Blick auswählt, Tradition verändert, Wirklichkeit und Stereotypen stört und neu erfindet. «Ich bin ganz Auge», könnte dieses Bild aussagen, ich bin nicht der Körper und die Schönheit, als die ich in männlichen Werken repräsentiert und in den Blick genommen werde. Das porträtierte Auge, das Augen-Porträt, wäre dann auch ein Gegenbild zu Man Rays bekanntem Kultbild der nackten, mit Druckerschwärze beschmierten und so zum Objekt des männlichen Fotografen werdenden jungen Meret Oppenheim.[11] Oppenheim hat sich bekanntlich immer wieder dagegen gewehrt, dass in diesen Fotografien schon ihre Künstlerinnen-Identität zutage träte; da war sie ganz Muse, bevor sie ganz Auge wurde.
Bleibt noch die Beziehung von Mund und Auge zu analysieren: Die wie zum Sprechen geöffneten Lippen des Kunsthistorikers öffnen das Bild fast buchstäblich, eine Öffnung, die die verschlossene Repräsentation herrschaftlicher und gelehrsamer Provenienz konterkariert. Über geschlossene und geöffnete Lippen im Porträt liesse sich trefflich eine kleine Untersuchung anstellen. Erst in der Malerei und Skulptur des 18. Jahrhunderts finden sich die geöffneten, zum Gespräch ansetzenden oder lächelnden Lippen gehäuft, wobei Rembrandt (1606–1669) in seinen Selbstbildnissen diese ikonographische Innovation dynamisiert haben dürfte.
Wie Svetlana Alpers gezeigt hat, verwandelte Rembrandt die Bürde der Porträtaufträge zu seinem künstlerisch-kreativen Markenzeichen, indem er das Selbstporträt neu erfand und anscheinend zum Selbsterforschungsinstrument erklärte. Sein Mund avancierte zur Provokationsformel des Porträts und übertrug dabei bestehende Formeln vom Genre in die höherstehende Gattung des Porträts. Dieser Neuheit konnte sich kaum ein fürstlicher oder königlicher Hof in Europa entziehen – eine faszinierende Geschichte der Selbstermächtigung des Künstlers im höfischen System.

Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Sogar die Porträts von Sängern mit offenem Mund sind dann im 18. Jahrhundert, etwa im Werk des englischen Malers Thomas Gainsborough (1727–1788), in der Epoche der Entdeckung des Subjekts und der Humanisierung der rezeptionsästhetischen Kommunikation zwischen Bild und Betrachter, zu finden. Zu denken ist auch an die Darstellung einer neuen Kommunikationsform über Kunst, nämlich an das «Kunstgespräch», wie es beispielsweise Johann Eleazar Schenau 1772 darstellte. (Abb. 2) Ungezwungen, nicht-autoritär sollte sich hier ein Austausch über die Künste entfalten, ganz jenseits ihrer Funktionen als Bildmaterial für absolutistische Herrschaft. Eine vorrevolutionäre soziale Formel, die dann schnell wieder, allzu schnell, in autoritäre, institutionalisierte Kunstgeschichten der Nationalmuseen übergehen sollte. Aber damals, als Goethe seinen schönen Text über den subjektiven Sammler – Der Sammler und die Seinigen – schrieb und 1799 veröffentlichte –, drehte sich der Diskurs um die Frage, wie sich wohl die Gedanken und Sehnsüchte des Subjekts im Verbund mit der Kunst Gehör und Sprache verschaffen könnten. Die romantischen Kunstgespräche sollten an diesen Impuls des «Strukturwandels» (Habermas) hin zu einer Kunst der bürgerlichen Öffentlichkeit mit grosser Liebe und Freundschaft anknüpfen als einer wunderbaren Utopie.
Von Liebe und Freundschaft ist denn auch viel die Rede in Goethes Erstem Brief. Am Ende desselben bringt Goethe noch eine Volte gegen die Erzählung und prononciert die Schwatzhaftigkeit positiv als Gegenkommunikations- bzw. Gegennarrativmedium: «Ich schließe diesen Brief, ohne meinen Vorsatz erfüllt zu haben. Ich schwätzte, anstatt zu erzählen.»[12] Die sprichwörtliche Schwatzhaftigkeit der «Weiber» eignet sich Goethe innovativ an, um die private Sammlung mit ihrer familiären Genealogie nicht ohne Selbstbewusstsein sogar den kommenden Nationalgalerien gegenüberzustellen; er geht auf die Dresdner Sammlungen ein, die dann nach dem Mauerfall 1989 tatsächlich als die eigentliche Nationalgalerie Deutschlands apostrophiert werden sollten. Goethes privater Sammler, der sich vor der herrschaftlich-nationalen Sammlung nicht verstecken will – das hatte Weitsicht. Goethe postuliert damit provokativ eine schwatzhafte Kunstgeschichte, eine zum mäandernden Gespräch aufgelegte Kunstgeschichte, die Franz Zelger in dem Porträt von René Burri trefflich in seiner Postur aufgreift.
Weiterhin ruft gerade die Absenz des lächelnden Mundes der Mona Lisa, welcher durch Meret Oppenheims malerischer, aneignender Herausbrechung des Auges aus dem Porträt-Ganzen umso präsenter ist, die ästhetische und durch das Stereotyp «Mona Lisa» getriggerte Notwendigkeit der Komplettierung auf. Zelgers Mund ersetzt das Lächeln der Mona Lisa, welches dadurch männlich angeeignet wird. Sie lächelt, er redet. Die hybride, referentiell aufgeladene und funktionierende Bildkomposition arbeitet durch diesen Kunstgriff dem unwillkürlich authentisch erscheinenden Männer-Porträt zu, für das Oppenheims Kunstwerk zum expressiven Hilfsmittel wird. Inwiefern ist dies ein typisches Werk von Burri, und welche Spuren von dessen Ausbildung und dessen Werdegang zeigen sich darin?
Hans Finsler, Heinrich Wölfflin und die Beziehungen zwischen modernistischer Fotografie und ästhetizistischer Kunstgeschichte
Zunächst ist hervorzuheben, dass Burri sein technisches und ästhetisches Handwerkszeug bei Hans Finsler (1891–1972) erlernte, von dem wir zum Beispiel seine durch Licht und Schatten stark formalisierten Darstellungen von Eiern kennen. Finsler ist eine legendäre Figur der Fotografie im deutschsprachigen Raum, auf dessen Rolle ich kurz eingehen möchte, weil er nämlich nicht zuletzt bei Heinrich Wölfflin in München Kunstgeschichte studiert und dieses Fach auch gelehrt hatte, bevor er sich ganz der Zürcher Fotoklasse verschrieb.
Verena Huber Nievergelt führt in ihrem Beitrag für das Lexikon zur Kunst in der Schweiz am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft über die Freundschaftszirkel und die Netzwerke Finslers folgendes aus: «Dort [in München] Bekanntschaft mit Hans Curjel (1896–1974), Sigfried Giedion (1888–1968), Franz Roh (1890–1965) und Carola Giedion-Welcker (1893–1979) und seiner späteren Frau Manuela Jana (Lita) Schmidt. 1921 Umzug nach Halle an der Saale wegen geplanter Promotion bei Paul Frankl (1925 abgebrochen), im selben Jahr Heirat und Geburt der Tochter Regula. 1922–1932 Tätigkeit an der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in Halle. Ab 1922 als Bibliothekar, ab 1923 als Lehrbeauftragter für Kunstgeschichte und Werbelehre, ab ungefähr 1926 Aufnahme von Fotografien von Objekten aus dem Unterricht zu Dokumentationszwecken, ab 1927 Lehrer für Fotografie an der neu gegründeten Fotoklasse, im selben Jahr Volontariat bei der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin, 1930 Festanstellung an der neu mit den anderen Lehrgängen gleich gestellten Fotoklasse. Parallel zur Lehrtätigkeit Sach-, Industrie- und Architekturaufnahmen für diverse Firmen und Institutionen […]; Publikationen in Zeitschriften und Katalogen, 1928 erfolgreiche erste Einzelausstellung in Halle. 1932 Mitglied Gesellschaft Deutscher Lichtbildner.»[13] Finsler kam von der Kunstgeschichte zur Fotografie und leitete wohl auch aus seiner Kenntnis formal-ästhetischer Begriffe seine streng auf das Objekt gerichtete fotografische Sichtweise ab. Formen und Strukturen sollten jenseits der Funktionsweisen und Bedeutungen des Objekts herausgearbeitet werden, so dass seine Überzeugungen auch der fotografischen Erneuerungsbewegung des «Neuen Sehens» und der «Neuen Sachlichkeit» entsprachen. Ganz ähnliche Kriterien finden sich in der amerikanischen «Straight Photography» und der sogenannten Bauhaus-Fotografie.
Burris Fotografien mögen keineswegs vollständig der strengen Schule Finslers entsprechen, sie enthalten aber doch mit ihren formalästhetischen Strukturen und Komponenten ein Echo dieser damaligen Neuerfindung der Fotografie. Das Porträt von Zelger können wir in diese Fotoästhetik einreihen, derzufolge die Fotografie als Fotografie sichtbar werden sollte und dafür Regeln erliess anstatt sich dem Abbilden von Dingen zu unterwerfen. Neben der formalisierten Komposition werden durch die Lichtführung die verschiedenen Muster und Texturen der Stoffe, des Jacketts und der Krawatte, die Falten der Haut, die Strukturen der Haare, die Korrespondenz zwischen den in der Fotografie dunklen Augen Zelgers und dem Auge der Mona Lisa zu Objekten des Mediums Fotografie und der Kreativität des Fotografen. Es kommen noch weitere Aspekte hinzu: Die zweite grosse und sicher noch wichtigere Erfahrung von Burri bildete seine Aufnahme in die Magnum Agentur, in der heute alle Bilder der Zelger-Fotografie-Session aufbewahrt werden. Diese Agentur wurde 1947 gegründet, um Fotografen und Fotografinnen aus ihrer Abhängigkeit von Auftraggebern zu befreien und Fotografen das Recht an den Negativen zu erhalten. Dieses Urheberrecht war die Voraussetzung für die künstlerische Selbstermächtigung der Fotografen. Aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs entwickelten die Magnum-Fotografen darüber hinaus eine «humanist» oder «concerned» photography, die den Menschen als Menschen reflektieren sollte, wobei ich hier auf den gesamten Komplex der Kriegsfotografie, die zentral für die Agentur war, nicht eingehe. Henri Cartier-Bresson (1908–2004) trug mit seinem Diktum des «entscheidenden Augenblicks» zu einer Ästhetik der Lebendigkeit und Unmittelbarkeit bei, die, auch wenn sie häufig inszeniert war, diesen menschlichen Aspekt zum Ausdruck bringen sollte. Cartier-Bresson stellte ebenfalls kommunikative Bezüge zwischen einem Bild im Bild und dem Bild des lebendigen Menschen her. Auch die geöffneten Lippen, der Ausdruck des Mundes jenseits porträthafter Pose des Ernsts oder des Lächelns, gehörte zu seinem ästhetischen Repertoire, welches Burri zum Beispiel in seiner Fotografie der Schauspielerin Ursula Andress übernahm. So wird deutlich, dass sich das Porträt Zelgers keiner rein zufälligen Komposition verdankt, sondern fotohistorischen, rezeptionsästhetischen Paradigmen einer modernen, zu sich selbst gekommenen Fotografie.
Das Insert von Pipilotti Rist in der Festschrift für Zelger: Die Frauen, die Farbe, die Fotografie. Oder: Von Pippi Langstrumpf zu Gott und zurück
Die heute weltweit wohl mit Abstand bedeutendste und sichtbarste lebende Schweizer Künstlerin, Pipilotti Rist (* 1962), steuerte einen Beitrag zur Festschrift Zelger bei.[14] Was hat es damit auf sich?
Zunächst besteht die Notwendigkeit, das Buch um 90 Grad zu drehen, um Pipilotti Rists Insert mit dem Titel SONNE DURCH DICH. Videostills_Freestyle_1999 anschauen zu können. «SONNE DURCH DICH» ist in fetten, gedrungenen Lettern gegeben, während der Name «Pipilotti Rist» typographisch vergleichsweise originell anmutet, jedenfalls Zeitgenössisches konnotiert.
«Sonne durch dich» spielt auf Bibelzitate an, in denen Gott durch sich die Sonne scheinen lässt und damit zum Symbol der Hoffnung wird. Selbstverständlich denken wir auch an die von Licht durchstrahlten Gottes- und Heiligenbilder der farbintensiven Glasfenster sakraler Räume. Blättern wir im Buch weiter, so sehen wir Frauenbeine auf einem Felsenvorsprung, dahinter das Meer. Die Sonne bricht sich an den Rändern der Unterschenkel – und blendet die Betrachtenden. Während das Meer und die Schuhe zu erkennen sind, wirkt der Bereich zwischen den Beinen grell erleuchtet, so dass die Oberflächen der Beine zu Trägern abstrakter farbiger Erscheinungen mutieren. Im Anschluss an diese Beine und Füsse sind in der nächsten Reproduktion eine prominent ins Bild gerückte Hand zu sehen, der Daumennagel ist blau gefärbt, nur durch das Licht. Und blitzt da ein Ring auf, in dem sich das Licht bricht und uns einmal mehr blendet, nicht sehend macht? Die folgenden Stills unterstreichen den Widerstand gegen die Lesbarkeit des Bildes mit intensiven Farben in Gelb- und Rottönen. Den Abschluss bilden eine surrealistisch anmutende Komposition und eine Narzisse, beides Bilder, die tradierte wahrnehmungspsychologische Zugänge verweigern. Der Abschluss mit der weissen Narzisse verweist auf den narkotischen Duft der seit der Antike bekannten Blume, die zum Sinnbild des von Ovid beschriebenen Narziss wurde. Diese Art der Narzisse wurde auch «Dichternarzisse» genannt. Von der biblischen Konnotation am Beginn des Inserts verläuft das Drehbuch hin zum Narzissmus schlechthin, womöglich zu dem der Künstlerin? In der Sehstörung würde sich dann ihre künstlerische Intervention manifestieren, ohne dass sie auf tradierte Symbole, Mythen und Archetypen verzichtet, die das Kunstwerk letztlich doch in Bildtraditionen verankern, so ephemer es auch in seiner Medialität, also den Erscheinungsspuren des Videos, daherkommen mag.
Das Bildelement in Grünschwarz, das wie eine Bildstörung wirkt, scheint einen Vorläufer in Meret Oppenheims Nebelkopf von 1974 zu haben. Das Bild verweigert eine unmittelbare Lesbarkeit und ruft stattdessen Wahrnehmungserlebnisse auf, die Fernsehen und Computer inkludieren.
Erhellend hinsichtlich der Brückenbildung zwischen Oppenheim und Rist ist u. a. das Verlaufsprotokoll von Meret Oppenheim aus dem Jahr 1965. Unter ärztlicher Kontrolle nahm sie Rauschmittel ein. Was sie schreibt, erscheint wie eine Erlebnis- und Leseweise von Pipilotti Rists Insert für die Zelger-Festschrift. «Ich schalte das Licht aus, auch weil ich wissen möchte, ob die Helligkeit in den Bildern von aussen durch die geschlossenen Lider dringe. Die Bilder sind meist pulsierende, bewegte Ornamente. Obwohl ich mich auch jetzt noch erinnere, dass das Mittel ursprünglich von einem Pilz kommt, den die Indianer benutzen, um, wie man mir erzählte, im Rausch ihre Götter und die Pracht ihrer versunkenen Paläste und Städte zu sehen, bewegen sich meine Bilder, wenn sie einmal geographisch bestimmbar sind, zwischen China-Orient und Jugendstil. Viel Beardsley, Pfauenfedern, Digitalis. Auch Paul Klee. Plastische Drei-und Vierecke. Starkfarbig mit deutlicher Zeichnung, aber nicht unorganisch bunt. Mit strahlenden Helligkeiten. Manchmal auch nur 1–2 Farben. Einmal ist alles am Perlen. Manchmal ist das Bild eine bewegte Relieffläche, manchmal dreidimensional, manchmal ein weiter Raum, dies seltener.»[15]
Zelgers Lehrer? Augen als Forschungsinstrumente
Mit dem Ansatz, das Kunstwerk sehend zu erforschen, vom Kunstwerk auszugehen und nicht etwa von dessen Ideengeschichte, setzte Zelger das kunsthistorische Selbstverständnis von Gotthard Jedlicka fort, den Roger Fayet in dieser Jubiläumsschrift ausführlich vorstellt. Neben Jedlicka nennt Zelger Peter Meyer, Adolf Reinle, Eduard Hüttinger, Richard Zürcher und Emil Maurer als seine Lehrer. Wie es auch heute thematische Überschneidungen zwischen den Lehrstühlen gibt, sowohl im Bereich des Mittelalters wie im Bereich der Moderne, meint man dies auch in früheren Phasen des Kunsthistorischen Instituts zu erkennen. So vertrat Emil Maurer nicht nur die Frühe Neuzeit, vor allem Italiens, sondern pflegte auch sein forschendes Interesse an der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts.[16] Zum Beispiel gibt es von ihm einen lesenswerten Text zum bis heute verkannten und von Julius Meier-Graefe sogenannten «barocken» Frühwerk Cézannes. Was Zelger von Maurer, welcher übrigens ebenfalls recht intensiv journalistisch tätig war, quasi mitgenommen haben könnte, ist, dass auch Maurer eine, wie es im Nachruf von Samuel Herzog in der Neuen Zürcher Zeitung vom 19. Januar 2011 heisst, Lust an der Kunst wecken wollte und seiner Leserschaft die Freiheit offerierte, eigene Schlüsse aus dem Schauen zu ziehen, anstatt die Dominanz des Gelehrten einzunehmen.[17] Zelgers Interesse für die Kunst des 19. Jahrhunderts, das Maurer geweckt haben könnte, lässt sich zum Beispiel an seinem Text für die Reihe kunststück ablesen, die vom Hamburger bzw. Frankfurter Kunsthistoriker Klaus Herding herausgegeben wurde. Man darf dabei diese Reihe, in der in einem handlichen Büchlein jeweils ein Kunstwerk analysiert wird, das hinten im Buch grossformatig ausgeklappt als Reproduktion zu sehen ist, als Symptom eines Fachs verstehen, das wieder näher heranrücken wollte an das originale Kunstwerk und seither ja auch das Kunstwerk als Material und Objekt stärker in den Blickpunkt gerückt hat. Zelgers Beitrag erschien 1991 unter dem Titel Arnold Böcklin. Die Toteninsel. Selbstheroisierung und Abgesang der abendländischen Kultur.
Kommen wir nun nochmal auf die beiden oben erwähnten Fotografien, die Franz Zelger und Che Guevara zeigen, zurück, dann erklärt sich die Verbindung wie folgt: Franz Zelger hat quasi subkutan eine revolutionäre Haltung eingenommen, die er durch seine Rhetorik, seine Gesten, seine Mimik und seine Kleidung andeutete, ohne sich offen in professorale Machtkämpfe zu begeben und Assimilierungen an die männliche Stereotypenbildung zu unternehmen. Das heisst allerdings keineswegs, dass ihm jegliches Machtbewusstsein, strategisches Durchsetzungsvermögen und Konkurrenzdenken gefehlt hätten. Ganz im Gegenteil, seine Postur der Harmlosigkeit, der transgendermässigen Buntheit und mitunter der leichten Verwirrung nach dem Motto «Achso, wirklich? Pause», die sein Gegenüber ebenfalls leicht verwirren konnte – «Meint er das jetzt so? – Was denkt er?» – unterstützten ihn geradezu darin, seine Ziele zu erreichen.
In einem Gratulationsschreiben formulierte der Freiburger Ordinarius Alfred A. Schmid 1983 an Zelger: «Ich weiss nicht, ob Du nun mit dem Herüberwechseln an die Universität dem Museumswesen ganz die Treue aufkündigst. Ich würde es bedauern, da Du für das Vermitteln von Kunst über eine ausgesprochene Begabung verfügst; Fachleute, die das können, ohne sich selber gegenüber den strengen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit auch in der Öffentlichkeitsarbeit preiszugeben, sind dünn gesät.»[18] Matthias Wohlgemuth hat diesen Briefauszug im Geleitwort der Festschrift für Zelger zitiert. Wohlgemuths ebenso bewunderte wie gefürchtete redaktionelle Feder passte übrigens geradezu perfekt zum strengen Regime Zelgers.
Wirklich bezeichnend für die subversive, schillernde Postur Zelgers ist, wie er sich spöttisch und ironisch der Vereinnahmung durch das Oral History-Projekt am Lehrstuhl für Moderne und Zeitgenössische Kunst von Philip Ursprung entzog, indem er darauf herumritt, dass er sich auch eine Karriere als Kiosk-oder Restaurantbesitzer hätte vorstellen können.[19] Vergleicht man dieses Interview mit denjenigen der anderen Kunsthistoriker, dann wird deutlich, dass Zelger auf alles Bedeutungsheischende geradezu höhnisch verzichtet und – anstatt sich zu verteidigen – die Berufung auf den Lehrstuhl als an ihn gerichtete persönliche Einladung darstellt. Man kann natürlich darin auch und gerade eine Machtdemonstration sehen. Jedwede Unterstellung toppt er und lässt die angriffige Fragerei, die Studierende im Rahmen einer «Übung» zu absolvieren hatten, im Sande verlaufen. Sicher lag ein abgründiges Lächeln auf den Lippen des Ordinarius. Und dass die Berufungskommission ihm quasi hinterhergelaufen sei, nämlich in das Kunsthaus Zürich, wo er eine Übung vor Originalen im Rahmen eines Lehrauftrags durchführte, bleibt ein Element seiner Legende, das mit hoher Wahrscheinlichkeit wahr sein dürfte.
Wer eine so diverse, rotierende «persona» kreiert hat, dürfte doch ‹Vorbilder› gehabt haben, aber keine Akademiker, sondern Künstler als Referenzfiguren. Francis Picabias La pomme de Pins, Saint Raphael, Februar 1922: Notre tête est ronde pour permettre a la pensée de changer de direction lieferte nicht allein den Titel zur Festschrift anlässlich von Zelgers 60. Geburtstag, sondern nimmt Bezug auf den selbsterklärten lustigen Künstler-Typus und Bohemien als nicht zuzuordnendem Künstler, als Vertreter der Nicht-Kunst Dada, die dann doch Kunstgeschichte schrieb. Vielsagend, selbstbewusst und nicht nur lustig, denn mit dieser Künstler-Postur sagt ein Kunsthistoriker: Ich bin sehr, sehr nah dran an der Kunst und damit den Ideenhistorikern und Theoretikern in ihren Schreibstuben weit voraus. So jemand benötigt vielleicht keine ‹Persönliche Website›: Das Kunsthistorische Institut der Universität Zürich listet die Emeriti auf einer extra Seite auf: https://www.khist.uzh.ch/de/institut/staff/emeriti.html. Auf dieser Seite verzichten Hubertus Günther (1991–2008), Stanislaus von Moos (1982–2005), Hans Rudolf Sennhauser (1985–1996) und Franz Zelger auf einen persönlichen, weiterführenden Link, – allesamt starke Persönlichkeiten mit selbstbestimmter Postur, und allesamt auf eine komplexe und komplizierte Art und Weise prägend für das Kunsthistorische Institut der Universität Zürich – ein neues, nur durch das Digitale sich ergebendes ‹Gruppenporträt›, das eine ganz andere Geschichte des Instituts erzählen würde, eine Geschichte von Lehrstuhlinhabern, die absolut nichts miteinander verband, ausser ihrer Individualität und ihres unverwüstlichen Selbstbewusstseins im Zeichen der Wissenschaft.
Die Postur jenseits der «big grants», die heute so bedeutend im akademischen System erscheinen, ist nun nicht nur zeitgemäss, sondern weist in die Zukunft, wie die internationale Forschung von erlesenen Gelehrten zeigt, die sich nach COVID-19 rückbesinnen wollen auf: Kreativität und Innovation – von Individuen.[20]