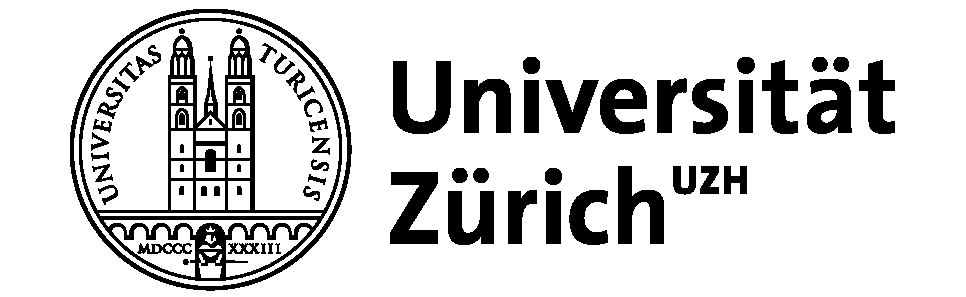Roger Fayet

© Walter & Konrad Feilchenfeldt/Courtesy Fotostiftung Schweiz.
Im Jahr 1934, als Heinrich Wölfflin in Zürich von seinem Amt als Ordinarius ad personam zurücktrat, wurde der soeben habilitierte Gotthard Jedlicka (Abb. 1) Privatdozent am Kunsthistorischen Seminar.[1] Auch wenn Jedlicka keineswegs der Nachfolger Wölfflins war – einen solchen gab es nicht –, so verkörperte er doch in methodischer und didaktischer Weise eine neue Generation. Während bei Wölfflin formale Analyse und eine auf begriffliche und systematische Verallgemeinerungen zielende, transhistorische Kunstwissenschaft im Zentrum stand, ging es bei Jedlicka um das individuelle und damit zwangsläufig zeitgebundene Erleben von Kunst. Und während Wölfflin als Fürsprecher einer Kunstgeschichte ohne Namen seine Befriedigung darüber kundtat, dass man ihm wenigstens nie werde vorwerfen können, eine Künstlerbiografie geschrieben zu haben,[2] sind Jedlickas grosse Monografien über Toulouse-Lautrec, Bruegel, Manet und Gubler stets auch als Biografien und in einer engen Verklammerung von Leben und Werk angelegt. Entsprechend verschieden nimmt sich der Schreibduktus der beiden aus: kurze, strenge Aussagesätze bei Wölfflin, eine spontan wirkende, ichbezogene, zuweilen belletristisch anmutende Ausdrucksweise bei Jedlicka. Nur folgerichtig differierten in ähnlicher Art auch die Vortrags- und Unterrichtspraktiken der beiden: Während es Wölfflin um die präzise Vermittlung überprüfbarer Erkenntnisse zu tun war, nahm Jedlicka oftmals seine eigenen Fragen zum Ausgangspunkt für eine Diskussion, die sich nicht selten mit zeitgenössischer Kunst befasste und auch dem Unvorhersehbaren Raum gab.

Foto: SIK-ISEA, Zürich (Martin Stollenwerk).
Der grösste Graben zwischen den beiden Kunsthistorikern tut sich allerdings im Blick auf ihre Rezeption auf. Sie hat Wölfflin zu einem der wenigen Klassiker der Kunstgeschichte gemacht, heute noch erforscht und gelehrt, und sie hat Jedlicka praktisch der Vergessenheit anheimgegeben. Die Gegenüberstellung eines Reliefporträts von Wölfflin und eines Bildnisses, das Max Gubler vom befreundeten Jedlicka angefertigt hatte, scheint das gegensätzliche Rezeptionsschicksal geradezu exemplarisch zu versinnbildlichen: Wölfflin zeigt sich im Profilbild, das, in Gips gearbeitet, den Dargestellten gleichsam als Klassiker verewigt (Abb. 2), während das flackernde, leicht mehransichtige Porträt Gublers «einen Menschen in seiner Gebrochenheit zeigt, seinen Ängsten und widerstreitenden Gefühlen».[3] (Abb. 3)

© Eduard, Ernst und Max Gubler-Stiftung, Zürich, Foto: SIK-ISEA, Zürich (Martin Stollenwerk).
Bereits 1974, keine zehn Jahre nach Jedlickas Tod, konstatierte Eduard Hüttinger, ehemaliger Schüler und Assistent und damals selbst Professor in Bern, dass das Werk Jedlickas «sich gegenwärtig in einem Wirkungstief»[4] befinde. Den Grund hierfür sah Hüttinger vor allem in Jedlickas Ferne zu jenen Methoden, die sich nach dem zweiten Weltkrieg als die dominierenden kunsthistorischen Praktiken etablierten, der Ikonologie zum einen, dem kunstsoziologischen Ansatz zum anderen.[5] In den mehr als vier Jahrzehnten, die seit Hüttingers Diktum verstrichen sind, hat Jedlickas Schaffen nicht aus dem Wirkungstief herausgefunden. Möglicherweise sind die 2019 erschienene Biografie von Rudolf Koella[6] und eine derzeit beim Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft in Vorbereitung befindliche Publikation über Jedlicka aber erste Anzeichen dafür, dass das eintreten könnte, was Hüttinger damals prophezeite: dass auf «Jedlicka, früher oder später, wieder das Licht der Aufmerksamkeit fallen» werde, «und sei es selbst vorerst nur in kritischer Beleuchtung».[7]
Biografisches
Der 1899 als Sohn einer österreichischen Bauerntochter und eines tschechischen Flachmalers geborene Gotthard Jedlicka wuchs in ärmlichen Verhältnissen im zürcherischen Arbeiterquartier Wiedikon auf. Nach der Primar- und Sekundarschule besuchte er dank der Unterstützung eines Hilfsvereins die sogenannte Industrieschule,[8] ein Gymnasium von kürzerer Dauer, das vor allem auf technische und kaufmännische Berufe vorbereiten sollte.

The Clark Art Institute, Williamstown, 2007.2.298, https://www.clarkart.edu/artpiece/detail/portrait-of-gotthard-jedlicka (aufgerufen am 6. April 2021).
Wie für einen jungen Mann aus wenig privilegierten Verhältnissen nicht untypisch, entschied sich Jedlicka zunächst für eine Ausbildung zum Primarlehrer, die er nach dem Abschluss mit dem Studium des Sekundarlehramts an der Universität Zürich fortsetzte. Hier besuchte er parallel dazu Lehrveranstaltungen in Kunstgeschichte, zunächst bei Josef Zemp und Carl Brun, später auch bei Konrad Escher und Heinrich Wölfflin. Nach Erhalt des Lehrerdiploms arbeitete er für drei Jahre als Lehrer an einer Schule in Winterthur, worauf er 1925 entschied, sich ganz dem Kunstgeschichtsstudium zu widmen. 1928 schloss er bei Josef Zemp mit einer Promotion über Toulouse-Lautrec ab – etwa zu jener Zeit muss sich Jedlicka denn auch in Paris von Berenice Abbott porträtiert haben lassen, nun bereits dezidiert den Habitus eines Intellektuellen einnehmend. (Abb. 4) Die 1929 publizierte Dissertation umfasste, wie damals üblich, gerade einmal 48 Seiten; der bescheidene Umfang erweckt jedoch zu Unrecht den Eindruck, dass die Beschäftigung mit Toulouse-Lautrec oberflächlich gewesen sei, veröffentlichte Jedlicka doch noch im selben Jahr bei Bruno Cassirer in Berlin eine mächtige, 400 Seiten umfassende Monografie über den Künstler.[9] Die Habilitation erfolgte 1934 über Manet, und auch hier mündeten die Forschungen in eine umfangreiche Publikation.[10]

© Walter & Konrad Feilchenfeldt/Courtesy Fotostiftung Schweiz.
In seinen Erinnerungen an Wölfflin (Abb. 5) schildert Jedlicka, wie er bei diesem in dessen Wohnung am Talacker in Zürich vorsprach, um ihn für die Unterstützung seines Habilitationsgesuchs zu gewinnen: «Seine Hausdame führte mich, nachdem sie mich aufmerksam gemustert hatte, in sein Arbeitszimmer, wo er mich, an seinem grossen Schreibtisch stehend, erwartete. Ich kann nicht behaupten, dass er mich herzlich empfangen hätte. Er kam mir nicht entgegen, sondern wartete ab, bis ich an seinen Schreibtisch herangekommen war, um mir die Hand zu einem kurzen Gruss entgegenzustrecken. ‹Sie haben gute Freunde!› war seine erste Bemerkung. ‹Ich gratuliere Ihnen!› Dann wies er mir einen Platz auf dem Sofa an, das an der Wand gegenüber dem Schreibtisch stand, während er sich auf den Stuhl am Schreibtisch setzte, den er nur so weit herumschob, dass ich in sein Blickfeld geriet. Ich dachte: ‹Die äussere Entfernung zwischen ihm und mir ist gerade so gross, dass eine ungezwungene Unterhaltung sich nicht einstellen kann.›»[11] Jedlickas Versuch, nach Wölfflins Klagen über das in seinen Augen magere Auditorium in Zürich das Gespräch auf das Handwerk des Schreibens zu lenken, mündete darin, dass dieser – in Anspielung auf Jedlickas schon damals beträchtlichen kunstschriftstellerischen Output – vorwurfsvoll bemerkte: «‹Da muss man schon Ihre Leichtigkeit im Schreiben haben, Herr Collega, wenn man am Schreiben Freude haben soll.›»[12] Trotz des nicht sehr glücklich verlaufenen Werbebesuchs und des bei Wölfflin anscheinend vorhandenen Eindrucks, Jedlicka habe seine Habilitation vor allem dank guter Kontakte zu anderen Kollegen der Fakultät erreicht, unterstützte Wölfflin das Vorhaben, und Jedlicka wurde 1934 Privatdozent am Kunsthistorischen Seminar. Fünf Jahre später folgte seine Ernennung zum Extraordinarius für neuere Kunstgeschichte, 1945 zum Ordinarius. Auf dieser Stelle blieb Jedlicka bis zu seinem Tod 1965 im Alter von 66 Jahren.
Unterricht
Jedlickas Unterrichtstätigkeit als Privatdozent begann mit einer Vorlesung über Pieter Bruegel und seine Zeit, über den er drei Jahre nach der ersten Vorlesung eine wiederum 400 Seiten starke Monografie veröffentlichen sollte,[13] gefolgt von Vorlesungen über Rubens, Rembrandt und die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Bald schon las Jedlicka auch über Manet, den Impressionismus, die französische, deutsche und schweizerische Malerei des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart sowie über die Plastik des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Proseminare, Seminare und Übungen erweiterten das Spektrum und nahmen auch methodische oder kunsttheoretische Fragen in den Blick, etwa Probleme der Bildbetrachtung, die kunstgeschichtlichen Grundbegriffe und die schweizerische Kunstliteratur.[14] Zu den Studentinnen und Studenten Jedlickas gehörten unter anderen Kurt W. Forster, Eduard Hüttinger, Rudolf Koella, Lisbeth Stähelin, Adolf Max Vogt, Stanislaus von Moos und Franz Zelger, um nur wenige zu nennen. Da viele von ihnen heute noch als Auskunftspersonen zur Verfügung stehen, fällt es nicht schwer, sich von der Unterrichtstätigkeit zumindest der späteren Jahre ein Bild zu machen. Rudolf Koella, Jedlickas letzter Assistent, berichtet in seiner Jedlicka-Biografie: «Jedlickas Vorlesungen waren stets gut besucht, besonders die einstündige, die sich meist mit moderner Kunst befasste. Da sie jeweils abends um achtzehn Uhr stattfand, waren ausser Studenten so viele Freifachhörer anwesend, dass dafür das Auditorium maximum zur Verfügung gestellt werden musste. In den frühen Sechzigerjahren, als ich bei Jedlicka studierte, hielt er diese Vorlesung stets in freier Rede, wobei er analysierend und kommentierend zwischen den ansteigenden Bankreihen auf und ab ging. Die zweistündige Vorlesung, die sich mit älterer Kunst, meist mit Malerei, gelegentlich auch mit Architektur befasste, war dagegen immer gründlich vorbereitet […].»[15] Besonders beliebt waren laut Annette Bühler Jedlickas Seminare vor Originalen im Kunsthaus.[16] Er habe sich dort ausgesprochen spontan verhalten, und es sei ungewöhnlich gewesen, wie sehr er die Studierenden selbst zu Wort habe kommen lassen. Diese Erinnerungen decken sich mit einer längeren Beschreibung, die Jedlicka von seinem Unterricht im Kunsthaus gibt und die wegen ihrer selbstreflexiven Dimension einigen Aufschluss darüber vermittelt, auf welchen kunsthistorisch-methodischen Grundannahmen Jedlickas Unterricht fusste.
Die Passage befindet sich in einem Aufsatz über Pierre Bonnards Gruppenbildnis La famille Terrasse, abgedruckt in Jedlickas Buch Wege zum Kunstwerk. Begegnungen mit Kunst und Künstlern von 1960.[17] Der Text hat die Form eines Briefes, den der Autor an seinen Freund Werner Weber richtet, damals Feuilletonchef bei der Neuen Zürcher Zeitung und später Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Weber hatte gegenüber Jedlicka bekundet, dass es ihm nicht gelungen sei, einen Zugang zu Bonnards Bild zu finden, das seinerzeit im Kunsthaus Zürich ausgestellt war und das Jedlicka erklärtermassen für ein Hauptwerk des Malers hielt. Jedlicka, der bereits in seinem Buch über Bonnard von 1949 ausführlich über dieses Werk geschrieben hatte,[18] teilt seinem Freund nun mit, er habe versucht, nochmals auf andere Weise an das Bild heranzukommen, nämlich indem er sich mit den Studentinnen und Studenten seines Proseminars vor das Gruppenbildnis gestellt habe. Bevor Jedlicka die Ergebnisse dieses Gesprächs vor dem Bild nachzeichnet, beschreibt er in allgemeiner Weise seinen Unterricht im Rahmen von Übungen vor Kunstwerken: «In meinen Übungen im Betrachten von Kunstwerken lerne ich lehrend nie aus. Wenn ich mich mit diesen jungen Menschen, unter denen sich (bisweilen) auch ältere, reife Menschen befinden, die sich entschlossen haben, noch einmal in die Schule zu gehen, mit der Erfahrung eines Lebens jung geblieben, vor ein Kunstwerk hinstelle, drei Viertelstunden, hin und wieder weitere drei Viertelstunden (vielleicht komme ich einmal so weit, das Wagnis zu unternehmen, ein ganzes Semester mit ihnen vor einem einzigen Kunstwerk auszuhalten), so weiss ich zu Beginn nie, wo wir am Ende der Zeit, die uns zu Verfügung steht, angelangt sein werden. […] Die Stunden, die ich am gründlichsten vorbereite, sind oft jene, die mich am wenigsten befriedigen, die am wenigsten echte Erkenntnisse und Einsichten herbeiführen. Ich trete vor dem Kunstwerk mit einer Reihe von bestimmten Fragen, die ich auf eine Weise angeordnet habe, die mir logisch zu sein scheint, an meine Studenten heran, beginne mit der ersten, die mir am besten geeignet scheint, die Begegnung mit dem Bild einzuleiten, warte ungeduldig auf die Antwort, die ich unbedingt brauche, um die weitere Frage stellen zu können, die sich, organisch, wie ich meine, aus dieser ersehnten Antwort ergibt – und bin enttäuscht, wenn die Unterhaltung in der Folge nicht so verläuft, wie ich sie mir, in Stichworten, auf einem Blatt notiert habe.
Ein solches Proseminar, wie soll ich es Dir beschreiben? […] Eine Gruppe von meist jungen Menschen einem Werk der bildenden Kunst gegenüber, im wesentlichen durchaus gewillt, ihm zu begegnen, sich seiner Wirkung hinzugeben und sich über die Gesetze, die diese bestimmen, Klarheit zu verschaffen: durch das Verlangen darnach überhaupt dahin geführt. Aber verschiedene Menschen erleben verschieden und sehen darum auch verschieden und sind oft im Recht, wenn sie vor einem Kunstwerk, mit dem sie ein Lehrer konfrontiert, nicht vor allem auf seine Fragen Antwort geben, sondern vor diesem aussprechen wollen, was sie vor ihm erleben, was ihnen daraus entgegentritt – und so tue ich oft gut daran, habe ich fast immer gut daran getan, zuerst nicht bestimmt zu fragen, nicht von vornherein bestätigt haben zu wollen, was sich in mir, nach einer langen Betrachtung, die ich für einen andern kaum voraussetzen darf, als eine Gewissheit herausgebildet hat, sondern meine jungen Menschen sagen zu lassen, was sie fühlen, empfinden, sehen, erkennen, was sie beglückt, unruhig macht. So bin ich bei der Betrachtung des Gruppenbildnisses der Familie Terrasse vorgegangen, und diese meine pädagogische Unbekümmertheit, die allerdings auf einem pädagogischen Instinkt beruhen kann, vielleicht auch mein Vertrauen zu meinen Studenten und Mitarbeitern hat sich wieder einmal gelohnt: für mich, für meine ganze Umgebung, meine ich, und auch für Dich.»[19] Mit der hier beschriebenen Unterrichtsmethode, die Jedlicka vor allem bei seinen Übungen im Kunsthaus anwandte, wählte er eine Praxis, die in ihrer Experimentierfreudigkeit und Ergebnisoffenheit für die Studierenden der 1950er- und 1960er-Jahre ungewohnt war. Zweifellos ist Jedlickas Herangehensweise zunächst einmal in der Tradition des fragend-entwickelnden Unterrichts zu sehen, wie er bereits in der Pädagogik der Aufklärung als Technik des selbständigen Lernens propagiert wurde und mit dem Jedlicka als ausgebildeter Primar- und Sekundarlehrer bestens vertraut sein musste. Im Bereich der Kunstpädagogik war es besonders Alfred Lichtwark, der um 1900 für eine möglichst voraussetzungslose, unmittelbare Begegnung mit dem Kunstwerk plädierte und ein darauf aufbauendes Lehrgespräch für die richtige Form der Vermittlung hielt. Jedlicka hatte ein Exemplar von Lichtwarks schmalem, aber äusserst wirkungsmächtigem Büchlein Übungen im Betrachten von Kunstwerken besessen.[20] Viele der in Lichtwarks Einleitung formulierten methodischen Grundsätze stimmen mit dem überein, was Jedlicka in der oben zitierten Textstelle als sein eigenes Vorgehen beschreibt: das absolute Primat des eigenen Beobachtens gegenüber der Aneignung von fremdem Wissen, die Konzentration auf das einzelne Kunstwerk, die Präferenz für Werke jüngerer, möglichst zeitgenössischer Kunst. So heisst es bei Lichtwark: «Die Gewöhnung, eingehend und ausdauernd zu beobachten, und das Erwecken der Empfindung, nicht die Mitteilung oder Aneignung von Wissen, sind die Ziele der Kunstbetrachtung.»[21] Ferner: «Der Grundsatz, beim einzelnen Kunstwerk zu bleiben, muss in der Praxis eher übertreibend zur Anwendung gebracht werden.»[22] Und schliesslich: «Dass mit der lebenden Kunst, d. h. mit der Kunst unseres Jahrhunderts, anzufangen sei, erscheint mir nicht zweifelhaft.»[23] Jedlickas Methode geht jedoch weit über das hinaus, was Lichtwark in den Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken, notabene für jüngere Schüler, propagiert hatte. Anstelle des dort vorexerzierten, stark durch die Fragen der Lehrperson gesteuerten Gesprächs setzte Jedlicka auf eine offenere, egalitäre Diskussion. Wie aus dem oben zitierten Brief über Bonnards La famille Terrasse hervorgeht, störte sich Jedlicka just an jenen Aspekten des fragend-entwickelnden Unterrichts, die ab den 1980er-Jahren in der Pädagogik auf breiter Front kritisiert werden sollten: die Gängelung der Lernenden durch eine zu enge Fragelogik, die Illusion, dass durch die Beantwortung der Fragen das Verständnis des Lehrenden mehr oder weniger eins zu eins auf die Lernenden überginge, die Künstlichkeit, die eine solche Gesprächssituation von allen echten Gesprächssituationen unterscheidet. Und er reagierte auf sein Unbehagen an den problematischen Eigenschaften des Lehrgesprächs, indem er praktizierte, was zum Beispiel der Literaturdidaktiker Kaspar H. Spinner 1992 von einem sinnvollen fragend-entwickelnden Unterricht forderte: Spielräume des Denkens zu eröffnen und nicht zu verbauen, die Vorstellung einer Gleichheit der Partner als leitendes Prinzip zu nehmen und die eigenen Unterrichtsmassnahmen als im eigentlichen Sinne fragwürdig zu erkennen.[24]
Erlebnis
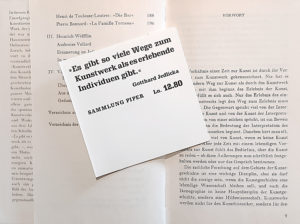
Foto: Roger Fayet.
Doch wäre es zu kurz gegriffen, Jedlickas Seminarunterricht bloss als die Übertragung einer im Volksschul- und Gymnasialunterricht geläufigen Praxis auf die Hochschullehre zu begreifen, vielmehr stand er in engem Zusammenhang mit den methodischen Prämissen, die für Jedlickas gesamtes Schaffen kennzeichnend sind. Einer der Schlüsselbegriffe, die sein hermeneutisches Vorgehen bestimmten, lautete «Erlebnis» beziehungsweise «erleben» – Begriffe, die sich auch in der Passage über den Unterricht im Kunsthaus finden: «Aber verschiedene Menschen erleben verschieden und sehen darum auch verschieden und sind oft im Recht, wenn sie vor einem Kunstwerk, mit dem sie ein Lehrer konfrontiert, nicht vor allem auf seine Fragen Antwort geben, sondern vor diesem aussprechen wollen, was sie vor ihm erleben, was ihnen daraus entgegentritt […].»[25] Dem Sammelband Wege zum Kunstwerk, in dem der zitierte Aufsatz enthalten ist, lag in der Erstausgabe zudem ein Buchzeichen bei (Abb. 6), das die Kernbotschaft des Buches mit einem Zitat aus dem Vorwort zusammenfasste: «Es gibt so viele Wege zum Kunstwerk als es erlebende Individuen gibt.»[26] Es liegt nahe, in Jedlickas radikaler Betonung der Erlebnisdimension eine Fokussierung auf die Rezeptionsseite zu sehen und seinen Ansatz demnach als eine rezeptionsästhetisch dominierte Methode zu begreifen. Eine breitere Lektüre seiner Schriften lässt jedoch erkennen, dass es seinem Verständnis nach zwei Orte gibt, an denen das Erleben – im Sinne einer ganzheitlichen, nicht nur den intellektuellen, sondern den ganzen Menschen involvierenden Wahrnehmung – auf die Kunst einwirkt, nämlich sowohl bei ihrer Entstehung als auch bei ihrer Betrachtung. Für Jedlicka geht das Kunstwerk aus einem Prozess hervor, in den der Künstler, die Künstlerin nicht nur als verstandesmässig agierende Person, sondern «als Ganzheit»,[27] das heisst als geistiges, fühlendes, körperliches und gesellschaftliches Wesen impliziert ist. Und da das Verhältnis des schöpferischen Menschen zur Wirklichkeit mitgestaltet wird durch das Erleben derselben, ist es nur folgerichtig, das Kunstwerk nicht allein als das Resultat eines Gestaltungsprozesses aufzufassen, sondern es in Beziehung zu sehen mit Vorgängen des Erlebens, die über die Sphäre des Künstlerischen im engeren Sinn hinausreichen. In einem Aufsatz über René Auberjonois schreibt Jedlicka über den Akt des Porträtierens – wobei sich das Gesagte sinngemäss auch auf die Darstellung anderer Gegenstände übertragen liesse: «Der Maler und Zeichner, der ein Bildnis ausführen will, steht als ein ganzer Mensch einem ganzen Menschen gegenüber – den er nun aber vor allem durch das Auge erlebt. Aber in diesem Sehen, in dem sich eine Begegnung vollzieht, lebt alles, was einen lebendigen Menschen bewegen kann: Gefühl und Empfindung, Wissen und Ahnung, Misstrauen und Zuneigung, Erkenntnis und Intuition […].»[28] Nicht weniger gilt auch für die Rezeption von Kunst, dass sie sich unter den Bedingungen eines umfassend verstandenen Erlebens vollzieht. Das wahrnehmende Subjekt war für Jedlicka eines, das in seiner Ganzheit dem Werk gegenübersteht, also seine individuellen emotionalen, intellektuellen, ja selbst körperlichen Voraussetzungen und Befindlichkeiten in den Rezeptionsvorgang einbringt. Die Betonung der Ganzheit des Menschen im Sinne einer Existenz nicht nur als Verstandeswesen, sondern als körperlich-sinnliches, emotionales und geistiges Wesen, hatte bei Jedlicka so viel Gewicht, dass gar von einer Art «Ganzheitspathos» gesprochen werden könnte. Immer wieder hat Jedlicka diese Ganzheit nahezu wie ein Mantra beschworen,[29] und es steht zu vermuten, dass sich hier eine Nähe zu Positionen der Lebensphilosophie, wie sie von Wilhelm Dilthey oder Henri Bergson vertreten wurde, manifestiert. Nun wären das Fühlen oder das emotive Wollen aus Sicht einer auf Objektivierung und Systematisierung zielenden Kunstwissenschaft eigentlich bloss Störfaktoren, die zugunsten eines rein kognitiven Verstehens besser ausgeschaltet würden. Für Jedlicka war ihre Eliminierung jedoch gar nicht wünschenswert, da ein Kunstwerk für die Betrachtenden erst dann Bedeutsamkeit erlange (das heisst, bedeutsam werde sowohl im Sinne von aussagekräftig und als auch im Sinne von wichtig), wenn die emotionale Dimension am Wahrnehmungsprozess Anteil habe. In seinem Buch über Bonnard bemerkt Jedlicka zu einem Besuch in der Galerie Maeght in Cannes: «Ich versuche, das eine oder andere dieser Bilder zu betrachten. Es gelingt mir nicht, ich empfinde nichts und sehe darum auch nichts.»[30] Erst indem ein Bild «empfunden wird», das heisst, in das Fühlen der Betrachterin, des Betrachters eingeht – «beglückt, unruhig macht»,[31] wie es Jedlicka ausdrückte –, ist die motivationale Voraussetzung für ein verstehendes Sehen gegeben. Da unter diesen Prämissen jede und jeder ein Werk anders erlebt, ist die Erzählperspektive, die diesem individuellen Erleben angemessen ist, die Ich-Perspektive. Tatsächlich schrieb unter den damaligen deutschsprachigen Autorinnen und Autoren kunstgeschichtlicher Texte wohl kaum jemand so häufig in der Ich-Form wie Jedlicka.
Begegnung und Beschreibung

Foto: SIK-ISEA, HNA 207.8.
Dadurch, dass für Jedlicka sowohl auf der Produktions- als auch auf der Rezeptionsseite das individuelle Erleben die entscheidende Instanz bildete, wird die Begegnung mit Kunst zur Begegnung zwischen zwei Menschen – «Begegnung» ist denn auch, nach «Erlebnis», der zweite Schlüsselbegriff in Jedlickas Schriften. Es ist daher nur konsequent, dass Jedlicka immer wieder bemüht ist, den Künstlern, deren Werke ihn interessieren, persönlich zu begegnen, ihnen gleichsam von Erlebendem zu Erlebendem gegenüberzustehen. (Abb. 7) Auch hält er diese Begegnungen für nicht weniger würdig, festgehalten und veröffentlicht zu werden, als die Ergebnisse seiner Beschäftigung mit den Kunstwerken selbst. Geradezu ‹in extremis› praktizierte er diesen Ansatz in den Beiträgen zur Aufsatzsammlung Begegnungen mit Künstlern der Gegenwart sowie in seinem Buch über Pierre Bonnard, das über 240 Seiten einzig und allein die erste Begegnung mit dem Künstler während eines Sommertags im Jahr 1946 beschreibt.[32] Für die Praxis einer solchen personenzentrierten Herangehensweise bedeutet dies, dass Jedlicka letztlich zu Aussagen finden musste, die den Künstler in seinem Wesen umschreiben und damit auch festlegen – Aussagen wie etwa diese: «Auberjonois hat die physische und psychische Selbstsicherheit eines wohlgeborenen, grossgewachsenen, aber nicht zu gross geratenen Menschen mit einem gesunden Menschenverstand und einer entwickelten Menschenkenntnis.»[33] Deutende Aussagen entwickeln sich bei Jedlicka jedoch stets aus langen Beschreibungen heraus, werden immer wieder anders modelliert und oftmals auch nachfolgend relativiert. So bildet der eben zitierte Satz nur den Einstieg in ein beinahe zwei Seiten währendes Kreisen um Auberjonois’ Charakter. Im Buch über Bonnard wiederum erscheint als Leitmotiv die vom Autor als herausragendes Merkmal empfundene Zärtlichkeit des Künstlers, die sich ebenso in seinen Werken wie in seinen alltäglichen Gesten äussere – eben weil sie als Teil seines innersten Wesens sowohl das Handeln und damit das künstlerische Schaffen als auch die äussere Erscheinung mitbestimme.[34] Dem Beobachten, dem bei Jedlicka nicht nur im Unterricht, sondern auch in seinem eigenen Umgang mit Kunst und Kunstschaffenden ein hoher Stellenwert zukam – so beschreibt er sich in seinen Büchern selbst immer wieder als exzessiven Beobachter –, entsprach auf der Ebene des Festhaltens und des Vermittelns das Beschreiben. Die Beschreibung war das Verfahren, über das Jedlicka sowohl die Erschliessung von Kunstwerken als auch die Charakterisierung von Persönlichkeiten anging. Beschreibungen dominieren nicht nur seine kürzeren, je einem einzelnen Werk gewidmeten Texte, wie sie beispielsweise im Sammelband Anblick und Erlebnis. Bildbetrachtungen von 1955 enthalten sind.[35] Auch die Bildanalysen in der Bruegel-Monografie beruhen auf durchweg sehr ausführlichen Ekphrasen, während Hinweise zur Forschungsliteratur in den Anmerkungsapparat verschoben sind.[36] Selbst die oben beschriebene Unterrichtsstunde vor Bonnards La famille Terrasse leitete Jedlicka ein mit der Frage «‹Was alles ist auf diesem Bilde zu sehen?›»,[37] und er begründete sein Vorgehen damit, dass es «keinen andern Weg in das Innere eines Bildes, eines Kunstwerks, [gibt] als den von aussen her, wobei an diesem Aussen, das mit Worten erfasst und beschrieben zu werden vermag, alles mit demselben Ernst in Betracht gezogen werden muss […]».[38] Einem im Grunde phänomenologischen Paradigma folgend, ergeben sich Jedlickas Deutungen der Werke stets aus deren Beschreibungen. Im Zuge ihrer Deskription entfalten sich die für ihre Interpretation wesentlichen Eigenschaften. Dabei kommt es zu einem Wechselspiel zwischen der formalen Analyse und, wie es bei Jedlicka heisst, der «psychischen Beziehung»[39] zum Werk, so dass sich die Zielrichtung von Beschreibung und Analyse, beeinflusst durch die bereits erfolgten Schilderungen, laufend weiterentwickelt. Manchmal erzwinge das Kunstwerk geradezu «eine bestimmte Art der Betrachtung und Beschreibung»,[40] die dann auch intuitiv gefunden werde. Jedlicka hat sich, soweit bekannt, nie ausdrücklich auf die Theorie der Phänomenologie berufen, doch entspricht sein Vorgehen in vielerlei Hinsicht dem, was die phänomenologische Methode auszeichnet, so etwa in der Enthaltung von tradiertem Wissen oder von theoretischen Vorannahmen.
Schluss

werk, 53 (1966), Heft 2, S. 79.
Bemerkenswert an Jedlickas Œuvre ist weniger, dass eine kunsthistorische Methode, die ihre Fundamente im individuellen Akt des Beobachtens und Erlebens hat, sich in entsprechenden Praktiken des Unterrichtens niederschlug (Abb. 8); bemerkenswert ist vielmehr, dass es im Falle von Jedlicka auch umgekehrt gewesen sein könnte: Dass ein genuines, auch biografisch begründetes Interesse an Prozessen des Lernens und Lehrens – verstanden als echte Erkenntnisprozesse, nicht als didaktische Spiegelfechtereien – die Herausbildung einer Methode begünstigt hat, die nicht über die Rekapitulation bereits vorhandener Wissensbestände, sondern über einen möglichst unmittelbaren Beschreibungs- und Analysevorgang an die zu untersuchenden Gegenstände herantritt. Jedlickas Methode wäre demnach weit über ihre unterrichtspraktische Anwendung hinaus eine «pädagogische», indem sie darauf zielte, nicht bloss die Studierenden, sondern alle, selbst den Wissensvermittler, in die Rolle des Lernenden zu versetzen.