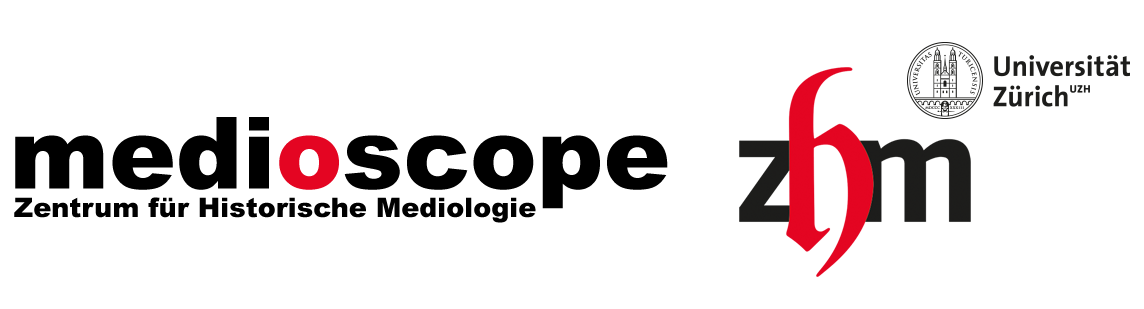Viele Objekte der mittelalterlichen Kunst und Kultur bestehen typischerweise aus den kostbarsten und seltensten Materialien.[1] Insbesondere Dinge, die in physischer Realpräsenz mit dem Heiligen (z. B. Reliquiare) oder innerhalb erzählender Texte mit dem Wunderbaren (z. B. Zelte, Automaten, Schwerter) in Verbindung stehen, erhalten zusätzlichen Glanz und sind häufig zu großen Teilen mit Edelsteinen besetzt.[2] Die wertvollen Steine dienen dabei aber nicht ausschließlich der Aufwertung und Zierde der einzelnen Kunstwerke, sondern können in verschiedener Hinsicht funktionalisiert sein. Neben allegorischen Implikationen, die insbesondere in der christlichen Exegese mit den Steinen zusammenhängen, sind es auch spezifische Konfigurationen des Materials, die in bildender Kunst und Literatur in besonderer Weise produktiv gemacht werden.[3]
Das Heinrichs-Kreuz aus dem Basler Münsterschatz
Ein Beispiel aus der Schatzkunst, an dem dieser Umgang mit dem Material nachvollziehbar wird, bildet das zu Beginn des 11. Jahrhunderts entstandene Heinrichs-Kreuz aus dem Basler Münsterschatz, das sich heute im Kunstgewerbemuseum in Berlin befindet (Abb. 1).

Dieses sogenannte ›Gemmen-Kreuz‹ ist mit verschiedenen Steinen, bunten Edelsteinen und Silberperlen besetzt und verfügt in seiner Mitte zudem über eine ovale kaiserzeitliche Chalzedon-Phalera.[4] Aufgrund ihrer symmetrischen Anordnung ziehen jedoch eher die in die Kreuzarme eingefassten Reliquienbehälter den Blick auf sich: Hinter glasklaren Bergkristallen verschlossen sollen sich Partikel des Heiligen Kreuzes sowie seit dem 14. Jahrhundert auch Reliquien des heiliggesprochenen Kaisers Heinrich II. befinden.[5] Die Heiligblutreliquie, die sich ebenfalls in einem der Behälter befunden haben soll, fehlt indes.[6]
Da der Bergkristall die Eigenschaft besitzt, besonders klar zu sein, bietet sich gerade dieser dazu an, die Reliquien innerhalb des Reliquiars sichtbar zu machen. Eine derartige Präsentation des Heils, die gleichermaßen Enthüllung und Verschluss ist, entwickelt sich erst langsam ab dem 11. Jahrhundert, seitdem Reliquien zunehmend sichtbar ausgestellt wurden.[7] Mit dem vierten Laterankonzil von 1215 wurde dann auch offiziell festgelegt, dass Reliquien nicht mehr außerhalb ihrer Reliquienbehälter gezeigt werden dürfen.[8] Mit der Sichtbarmachung von Reliquien – das Diaphane eines (Berg-)Kristalls nutzend oder, wie bei Handreliquiaren, die Form der Körperteile imitierend – geht ein medialer Wandel einher, der auch Einfluss auf die Kommunikationsstruktur und den Umgang mit den Objekten nimmt. Auf der visuellen Ebene wird auf diese Weise eine größere Nähe zum Heiligtum geschaffen. Im gleichen Zuge rücken die Reliquien jedoch auch auf Distanz, da sie durch den (transparenten) Verschluss nicht mehr bei jeder Gelegenheit, sondern lediglich zu hohen Festen entnommen werden und berührt werden können.[9]
Die in das Heinrichs-Kreuz eingearbeiteten Bergkristalle stehen zunächst ganz in der Funktion, die verschlossenen Reliquien sichtbar zu machen. Es lassen sich jedoch noch weitere Effekte feststellen, die vor allem auf die Bearbeitung und Anordnung des Materials zurückzuführen sind: Der besondere Cabochonschliff etwa erzeugt ein besonderes Strahlen des Kreuzes im Allgemeinen und im Besonderen auch ein Aufleuchten der darin eingefassten Reliquienbehälter.[10] Darüber hinaus scheint sich durch den Schliff ein lupenartiger Effekt einzustellen, der die Reliquien sowie die teilweise auch mit Bildern und Inschriften versehenen Reliquienbehältnisse aus dem Kreuz hervortreten und vergrößert aussehen lässt (Abb. 2).

Das konservierte Heil wird folglich nicht nur sichtbar, sondern mittels spezifischer Darstellungsformen in besonderer Weise präsentiert. Dabei hängt die Art und Weise der Darstellung eng mit den Materialeigenschaften des Bergkristalls zusammen, der sich aufgrund seiner Transparenz einerseits und seiner Bearbeitbarkeit andererseits geradezu dazu anbietet, die Behältnisse sowohl zu verschließen als auch die darunterliegende Reliquie so sichtbar zu machen, dass sie die Aufmerksamkeit der Betrachtenden auf sich zieht. Doch die Funktionen des Bergkristalls für die Reliquienbehälter sind auch an dieser Stelle noch nicht ausgeschöpft, denn mit den Eigenschaften und Wirkfunktionen des Materials verbinden sich in diesem Zusammenhang auch allegorische Implikationen.
Der Bergkristall zwischen Materialeigenschaften und Allegorese
Steine, insbesondere Edelsteine stellen in der Kultur des Mittelalters keine tote Materie dar, sondern sind mit verschiedenen Wirk- und Heilkräften verbunden. In den zahlreichen Lapidarien des Mittelalters werden die jeweiligen Steineigenschaften eingehend systematisiert und etwa alphabetisch oder nach Farbe, Funktion, Kälte, Hitze, Heilkraft etc. sortiert.[11] Als Grundlage für die mittelalterlichen Lapidarien gelten überwiegend antike enzyklopädische und naturkundliche Quellen, wie die mineralogischen Auseinandersetzungen von u. a. Platon, Aristoteles, Theophrast, Plinius d. Ä. und Solinus.[12] Im Mittelalter werden diese Betrachtungen, etwa jene des Isidor von Sevilla, Hrabanus Maurus oder Marbod de Rennes, um eine zusätzliche Bedeutungsebene erweitert, indem den jeweiligen (Edel-)Steinen eine christlich-allegorische Dimension hinzugefügt wird.[13] In diesem Zusammenhang werden nicht nur Steine als realiter existierendes Material behandelt, sondern auch die in der Bibel vorkommenden ›erzählten‹ Steine. Eine umfassende Exegese hat die ausschließlich aus Edelsteinen bestehende Stadt des ›Himmlischen Jerusalems‹ aus der Johannes-Offenbarung erfahren. Die zwölf Tore der Himmelsstadt beispielsweise werden in Hieronymus’ theologischem Kommentar als Kristalle gedeutet, was er damit begründet, dass sie immer geöffnet seien (Offb 21,15).[14] Diese im Kommentar beschriebene Offenheit oder vielleicht auch visuelle Durchlässigkeit bezieht sich auf die hier nun bereits mehrfach genannte Haupteigenschaft des (Berg-)Kristalls, die schon bei Plinius d. Ä. darin besteht, besonders klar und rein zu sein.[15] Diese Transparenz des Steins ist in den antiken Quellen vor allem damit erklärt worden, dass dieser aus Wasser, Schnee oder Eis besteht und in hohen Gebirgslagen über einen langen Zeitraum aushärtet.[16] Die Klarheit und Lichtdurchlässigkeit wird in der mittelalterlichen Steinallegorese mit Keuschheit und Reinheit verbunden, die durch keinen Schmutz der Sünde getrübt werden könne.[17] Die Herleitung der Entstehung des Kristalls aus Wasser gibt bei Hrabanus Maurus und Gregor dem Großen den Anlass, den Kristall symbolisch mit Christus generell, in spezifischer Weise aber auch mit dessen Lebensereignissen wie Inkarnation, Taufe und Auferstehung in Verbindung zu bringen.[18] Aus dieser Deutung heraus wird die Verwendung von Bergkristall in Reliquiaren um eine weitere Bedeutungsebene ergänzt und aufgrund von sowohl realiter materiellen Eigenschaften als auch von allegorischen Implikationen zum Medium der Wahl, wenn es um die Darstellung von Passionsreliquien geht.[19]
Die mittelalterliche Steinallegorese greift folglich antike naturkundliche und enzyklopädische Quellen auf und erweitert die darin bereits verhandelten Wirkkräfte und Eigenschaften um eine christliche Dimension. Die jeweiligen allegorischen Implikationen, wie etwa Reinheit oder Freiheit von Sünde sind dabei eng an die Materialeigenschaften geknüpft. Im gleichen Zuge können anhand des Materials wiederum damit in Verbindung stehende menschliche Eigenschaften abgelesen werden. Damit ergibt sich hier ein komplexes Gefüge, in dem das Material, innerhalb spezifischer Wissenskontexte und -diskurse, in einen Kommunikationsprozess eintreten kann, der sich zwischen Betrachtenden und Betrachtetem entfaltet.
Der Tugendstein im Wigalois
Das umfangreiche Wissen um die spezifischen Eigenschaften von (Edel-)Steinen ist nicht nur in mittelalterliche theologische Texte und Lapidarien eingeflossen, sondern auch in die Höfische Literatur. Wie beim Heinrichs-Kreuz aus dem Basler Münsterschatz dienen die Edelsteine auch hier nicht allein als Schmuck von Rüstungen, Schwertern, Gräbern, Mänteln oder Zelten, sondern spielen im Hinblick auf Struktur und Handlungslogik des Textes eine zentrale Rolle.[20] Ein Beispiel für einen dieser besonderen Steine, der auffällige Ähnlichkeiten zu einem Bergkristall aufweist, findet sich in Wirnts von Grafenberg spätem Artusroman Wigalois, der etwa um 1210/1220 entstanden ist. In der Passage, um die es mir im Folgenden geht, erreicht der titelgebende Held Gwigalois den Artushof, um dort zum Ritter ausgebildet zu werden.[21] Doch noch bevor Gwigalois willentlich auf sich aufmerksam macht, wird er vor den Toren des Artushofs auf einen besonderen Stein aufmerksam, von dem er nachgerade angezogen wird.[22] Er nimmt auf dem breiten Stein Platz, der praktischerweise unter einer Linde gelegen den Blick auf den Hof freigibt und beobachtet das Geschehen. Der Stein wird im Text nicht direkt als Edelstein beschrieben, weist aber Eigenschaften auf, die denen des (Berg-)Kristalls sehr nahestehen. Der Stein ist
gevieret und niht sinwel;
striemen rôt unde gel
giengen dar durch eteswâ:
daz ander teil daz was blâ,
lûter als ein spiegelglas.
(V. 1480–1484)
[er war würfelförmig, nicht rund;
rote und gelbe Streifen
gingen hie und da durch ihn hindurch;
das Übrige war blau,
rein wie Spiegelglas.]
Schon die Form des Steins verweist darauf, dass es sich hier um keinen gewöhnlichen Stein, sondern um bearbeitetes, möglicherweise geschliffenes Material handelt. Es ist bemerkenswert, dass die Miniatur der Donaueschinger Handschrift einen runden Stein illustriert, der darüber hinaus auch das bunte Farbspektakel nicht mit aufnimmt (Abb. 3). Die Leidener Handschrift hingegen zeigt den geschliffenen Stein und bildet auch die verschiedenen Farben mit ab (Abb. 4).


Die Farben – rot, gelb und blau – sind sich dabei nicht als konstante Farbgeber vorzustellen, sondern bewegen sich als dynamische striemen (V. 1481) durch den Stein hindurch. Trotz des Farbenspiels weist der Stein auch transparente Stellen auf. Die Vermutung, dass es sich bei dem Stein um einen Kristall handelt, wird durch die Verwendung des Wortes lûter, mittelhochdeutsch für ›hell‹, ›rein‹ oder ›klar‹, nahegelegt. Doch die lûterkeit wird nicht nur auf der Ebene des Materials relevant. Denn wie kurz nach der Beschreibung der äußeren Merkmale deutlich wird, stellt der Stein eine Tugendprobe dar: Niemand, der sich jemals unredlich verhalten hat, kann eine Hand auf den Stein legen (siehe V. 1486–1488), maximal kann er sich auf einen Klafter daran annähern (siehe V. 1495–1497).[23] Artus ist der Einzige, der auf dem Stein sitzen kann. Alle weiteren Mitglieder der Hofgesellschaft weichen vor dem Stein zurück und können sich nur je nach Tugendhaftigkeit auf eine bestimmte Entfernung an ihn annähern (siehe V. 1498). Sogar Gawein, der beste aller Artusritter, kann aufgrund eines moralischen Fehlverhaltens lediglich eine Hand auf den Stein legen (siehe V. 1506–1516). Dass der junge Gwigalois dann ebenso wie Artus auf dem Stein sitzen kann, ist für den Artushof eine große Sensation und wird als wunderlîch (V. 1526) bezeichnet. Damit wird der Tugendstein zum zentralen Bezugspunkt der Aufmerksamkeit. Nicht der Neuankömmling beobachtet den Hof und verschafft sich einen Eindruck vom Geschehen, sondern ganz im Gegenteil: Gwigalois ist es, der hier beobachtet wird. Die Blicke der Öffentlichkeit machen hier allerdings nicht vor körperlichen Grenzen halt, denn dadurch, dass Gwigalois überhaupt auf dem Stein sitzen kann, werden auch seine inneren Eigenschaften sichtbar. Dem Stein wird damit auch ein medialer Status zuteil, der eng mit der Konstitution des erzählten Materials zusammenhängt: Die lûterkeit des Steins korrespondiert mit der Funktion, die Reinheit und Tugendhaftigkeit nach außen hin zu kommunizieren und die mit ihm interagierende Figur in gewisser Weise zu ›durchleuchten‹. Etwas überspitzt könnte man hier formulieren, dass der Held durch den Akt des Sitzens auf dem Tugendstein für die Hofgesellschaft genauso durchsichtig wird wie der Kristall selbst.
Als Element des Wunderbaren weist der Tugendstein verschiedene Wirkweisen auf, die über die tatsächlichen Materialeigenschaften des Kristalls hinausgehen.[24] Dies äußert sich etwa in seiner Anziehungskraft, seiner Funktion, die Tugendhaftigkeit derer, die mit ihm interagieren, zu testen, oder in der dynamischen Farbgebung. Unabhängig von diesen Wirkweisen übt der Stein auch Einfluss auf das soziale Gefüge des Artushofes aus und bildet dessen Hierarchie insofern ab, als er sie in Nähe und Ferne unterteilt.[25] Dieser Exklusionsmechanismus wird, ganz der Tugendprobe entsprechend, auch physisch sowohl für die Hofgesellschaft als auch für die Rezipierenden sichtbar und ablesbar. Das Ergebnis ist daher auch in physischer und räumlicher Form präsent und fungiert nicht bloß auf symbolischer oder allegorischer Ebene. Die Kategorie des Wunderbaren greift hier auf die Materialeigenschaften des Bergkristalls zurück, die in den zeitgenössischen Wissensdiskursen mit ihm verbunden waren.[26] Dabei werden die allegorischen und symbolischen Implikationen von Reinheit und Tugend zwar aufgegriffen, für den höfischen Roman aber in anderer Form funktionalisiert. Auch wenn der Held während der Tugendprobe für die Hofgesellschaft in die gleiche unerreichbare Ferne rückt wie die Passionsreliquie hinter dem Kristallglas im Reliquiar, ergeben sich aus diesem Akt handfeste Konsequenzen. Durch das Sitzen auf dem Stein und die ›Durchleuchtung‹ des Helden vollzieht sich ein für die weitere Handlung des Textes wichtiger Schritt, denn der Akt bestimmt, wenn auch nur für den Moment, den Platz des Ritters in der Hierarchie des Hofes.[27] Selbst wenn die tatsächlichen Auswirkungen der Tugendprobe fraglich sind, weil Gwigalois am Artushof dann erneut einer Ausbildung unterzogen wird und sich durch weitere ›âventiuren‹ beweisen muss, wird anhand der Konstellation des Materials bereits die besondere Eignung, das Charisma oder auch die Auserwähltheit des jungen Ritters unterstrichen.[28]
Die lûterkeit des Bergkristalls findet damit sowohl in der sakralen Schatzkunst als auch innerhalb des höfischen Romans Anwendung. Trotz der verschiedenen Kontexte, in denen sich das Gemmen-Kreuz aus der Schatzkunst einerseits und der erzählte Tugendstein aus einem Text der Artusliteratur andererseits befinden, greifen sie in ihren Darstellungsformen in ähnlicher Weise auf die in zeitgenössischen Wissensdiskursen virulenten Materialeigenschaftendes Bergkristalls zurück, machen sich diese jedoch in unterschiedlicher Weise produktiv.
[1] Die Arbeiten an diesem Thema sind im Rahmen eines in Kooperation mit Dr. Alan Lena van Beek im März/April 2022 durchgeführten Projekts entstanden, das durch die Förderung des Dahlem Junior Host Program des Dahlem Humanities Center an der Freien Universität Berlin ermöglicht wurde. Dafür möchte ich mich hiermit ganz herzlich bedanken.
[2] Als Beispiele können hier der Zaubergürtel in Wirnts von Grafenberg Wigalois, das mit Edelsteinen besetzte Zelt in Ulrichs von Zatzikhoven Lanzelet oder auch die Automaten im Straßburger Alexander herausgegriffen werden, um nur einige wenige zu nennen.
[3] Zur mittelalterlichen Edelsteinallegorese siehe die grundlegende Studie von Meier, Christel: Gemma spiritalis. Methode und Gebrauch der Edelsteinallegorese vom frühen Christentum bis ins 18. Jahrhundert. Teil 1. München 1977 sowie den Beitrag: Meier, Christel: Edelsteinallegorese, in: Anton Legner (Hg.): Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln. Bd. 3. Köln 1978, S. 185–187.
[4] Für eine ausführliche Beschreibung und Interpretation des Heinrichskreuzes siehe Lambacher, Lothar: Die Heinrichsgaben – Reliquienkreuz, in: Brigitte Meles (Hg.): Der Basler Münsterschatz. Historisches Museum Basel. Basel 2001, S. 19–24.
[5] Siehe ebd., S. 19f.
[6] Ebd.
[7] Lange wurde davon ausgegangen, dass dieser Wandel erst im 13. Jahrhundert einsetzt. Jedoch lassen sich bereits an frühmittelalterlichen Reliquienbehältern Bergkristalle finden, die genau diese Funktion übernehmen. Siehe zu dieser ersten Annahme Meyer, Erich: Reliquie und Reliquiar im Mittelalter, in: Ders. (Hg.): Festschrift für Carl Georg Heise. Berlin 1950, S. 55–66, und die Aufarbeitung bei Henze, Ulrich: Edelsteinallegorese im Lichte mittelalterlicher Bild- und Reliquienverehrung, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 54 (1991), S. 428–451, sowie auch die ausführliche Diskussion bei Kurtze, Anne: Durchsichtig oder durchlässig? Zur Sichtbarkeit der Reliquien und Reliquiare des Essener Stiftsschatzes im Mittelalter. Petersberg 2017, hier S. 15–23.
[8] Siehe dazu Meyer, Reliquie und Reliquiar (wie Anm. 7), S. 65. Siehe auch Laube, Stefan: Von der Reliquie zum Ding: Heiliger Ort – Wunderkammer – Museum. Berlin 2011, S. 54. Laube spricht mit Blick auf die Reliquiare auch von einem performativen Medium, siehe S. 56.
[9] Ausführlich auseinandergesetzt hat sich damit Kurtze: Durchsichtig oder durchlässig? (wie Anm. 7), S. 15–23.
[10] Auch Rudolf Friedrich Burkhardt spricht in seiner Beschreibung des Heinrichs-Kreuzes von einer lebendigen Silhouette und einem Farbenzauber; Burkhardt, Rudolf Friedrich: Der Basler Münsterschatz, in: Das Werk: Architektur und Kunst = L’ oeuvre : architecture et art 21 (1934), S. 41–47, hier S. 44f.
[11] Siehe dazu Wenderholm, Iris: Saxum – petra – lapis, in: Dies. (Hg.): Stein. Eine Materialgeschichte in Quellen der Vormoderne. Berlin/Boston 2021, S. 11–30, S. 20f.
[12] Siehe hierzu ausführlich Meier: Gemma spiritalis (wie Anm. 3), Kap. I.2.
[13] Siehe dazu ebenfalls ebd., Kap. I.3., wie auch Henze, Edelsteinallegorese (wie Anm. 7), S. 432f.
[14] Siehe dazu auch Henze, Edelsteinallegorese (wie Anm. 7), S. 444.
[15] Siehe zu dieser Eigenschaft den Überblick historischer Quellen bei Engelen, Ulrich: Die Edelsteine in der deutschen Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts. München 1978, S. 334–343.
[16] Siehe ebd., S. 335. Dazu Plinius d. Ä. Naturalis historia 37, 23; Isidor von Sevilla, Etym., 16,13. Diese Annahme ist jedoch schon unter den antiken und mittelalterlichen Gelehrten umstritten, da der Kristall auch in klimatisch wärmeren Regionen vorkomme. Siehe dazu die ausführlichen Skizzierungen dieser Auseinandersetzung bei Engelen: Edelsteine (wie Anm. 15), S. 55.
[17] Meier: Gemma spiritalis (wie Anm. 3), S. 237.
[18] Engelen: Edelsteine (wie Anm. 15), S. 339. Siehe dazu auch Henze, Edelsteinallegorese (wie Anm. 7), S. 446.
[19] Siehe dazu ebd., S. 447. Siehe auch Toussaint, Gia: Heiliges Gebein und edler Stein. Der Edelsteinschmuck von Reliquiaren im Spiegel mittelalterlicher Wahrnehmung, in: Das Mittelalter 8 (2008), S. 41–66.
[20] Siehe hier beispielsweise Walker-Bynum, Caroline: Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe. New York 2011, und mit gesondertem Blick auf die mittelhochdeutsche Literatur Mühlherr, Anna: Einleitung, in: Dies. u.. a. (Hg.): Dingkulturen: Objekte in Literatur, Kunst und Gesellschaft der Vormoderne. Berlin/Boston 2016, S. 1–20.
[21] Text und Übersetzung nach: Wirnt von Grafenberg: Wigalois. Text der Ausgabe von J.M.N. Kapteyn, hrsg. u. übers. von Sabine Seelbach und Ulrich Seelbach, Berlin/ New York 22014.
[22] Siehe dazu Eming, Jutta: Funktionswandel des Wunderbaren: Studien zum ‚Bel Inconnu‘, zum ‚Wigalois‘ und zum ‚Wigoleis vom Rade‘. Trier 1999, S. 163.
[23] Siehe dazu auch Linden, Sandra: Tugendproben im arthurischen Roman. Höfische Wertevermittlung mit mythischer Autorität, in: Hans-Jochen Schiewer (Hg.): Höfische Wissensordnungen. Göttingen 2012, S. 15–38.
[24] Zur Definition des Wunderbaren in der Literatur des Mittelalters siehe Eming: Funktionswandel des Wunderbaren (wie Anm. 22), S. 33–37, sowie Eming, Jutta/Quenstedt, Falk/Renz, Tilo: Das Wunderbare als Konfiguration des Wissens – Grundlegungen zu seiner Epistemologie, in: Working Paper des SFB 980 Episteme in Bewegung 12 (2018), S. 1–46.
[25] Dies zeigt ausführlich Selmayr, Pia: Der Lauf der Dinge: Wechselverhältnisse zwischen Raum, Ding und Figur bei der narrativen Konstitution von Anderwelten im ‚Wigalois‘ und im ‚Lanzelet‘, Frankfurt a. M. 2017, hier insbesondere S. 88–94.
[26] Dazu, wie das Wunderbare Wissensdiskurse aufnimmt und transformiert, siehe ausführlich: Eming/Quenstedt/Renz, Das Wunderbare als Konfiguration des Wissens (wie Anm. 24). Siehe auch Eming, Jutta: Magie und Wunderbares. Aspekte ihrer ästhetischen und epistemischen Konvergenz, in: Dies./Volkhard Wels (Hg.): Der Begriff der Magie in Mittelalter und Früher Neuzeit. Wiesbaden 2020, S. 81–111.
[27] Siehe dazu Selmayr: Der Lauf der Dinge (wie Anm. 25), S. 88–94.
[28] Zur Relevanz der Tugendsteinepisode für den weiteren Verlauf der Handlung siehe Eming: Funktionswandel des Wunderbaren (wie Anm. 22), S. 165.