Nicht nur aus kunstgeschichtlichen Gründen, sondern auch angesichts der besonderen ikonischen Verdichtung gilt Albrecht Dürers Hieronymus-Kupferstich aus dem Jahr 1514 zu Recht als Meisterwerk: Er inszeniert den Heiligen als Gelehrten ‹im Gehäus› mit dem Löwen, seinem treuen Begleiter. Zusammen mit dem ikonographischen Typus des Büßers in der Wüste hat dieses Sujet im Spätmittelalter ältere Darstellungsweisen abgelöst, die Hieronymus als Kirchenlehrer und Kardinal zeigten, der erhaben thront. Der Wechsel im Bildprogramm geht einher mit einer ab dem 14. Jahrhundert intensivierten Verehrung des Hieronymus, der Augustinus dann doch den Rang abzulaufen drohte, bei aller bleibenden Geltung augustinischer Theologie.

Bilder wie dieses werden unter den gegenwärtigen Ausgangsbeschränkungen gerne in sozialen Medien verbreitet – die neuerdings ihrem Namen gerecht werden und den Charakter ausschließlich ‹asozialer Netzwerke› (Hermann L. Gremliza) ablegen – als Ikonen geisteswissenschaftlicher Unabhängigkeit. Denn Hieronymus als Gelehrter im Gehäuse führt vor Augen, daß gerade der Arbeiter im ‹Weinberg des Texts› (Ivan Illich) im Grunde nur der Mußestunden bedarf, um produktiv zu sein. Hier wird Bleibendes geschaffen, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen.
Dieser Triumph der notorisch Unzeitgemäßen über die Zumutungen der Gegenwart ist einerseits psychologisch verständlich; andererseits handelt es sich aber auch um eine Täuschung. Denn wo der Gelehrte nicht das Glück einer voll ausgestatteten Privatbibliothek hat, die divini influxus ex alto (Marsilio Ficino) nicht mehr so recht strömen wollen oder der nach getaner Institutsarbeit in den Abendstunden zulässige Griff ins Weinregal am Vormittag nicht dieselbe Wirkung entfaltet, ist auch der Geisteswissenschaftler auf eine stabile Internetverbindung, einen VPN-Client und den damit möglichen Zugriff auf digitale Portale angewiesen. Auch der konservativste Gelehrte, der die Digital Humanities üblicherweise als üppig subventionierte Spielwiese großmäuliger crétins schmäht und Open Access für das Ende distinguierter Publikationskultur hält, greift dankbar auf das zurück, das bislang ‹im Netz› existiert.

Ja, sogar mehr noch: Im Bereich der nun digital abzuhaltenden Lehre wird auch der Dozent, der bislang auf Kopiervorlagen in Ordnern in der Bibliothek bestand, bei der Eitelkeit gepackt: Was da nicht alles an narzißtischer Selbstinszenierung möglich ist! Die nicht erlaubte physische Präsenz wird so nicht als Mangel erfahrbar, sondern eröffnet ungeahnte Fülle. Daß gerade an dieser Stelle aber Fülle und Mangel dialektisch zu denken sind – wo man sich Dialektik leisten kann, denn in Krankenhäusern und andernorts herrscht reiner Mangel –, zeigt ein distanzierter Blick auf die nun allenthalben zu findenden, in schlechtem Licht und aus ungünstigem Winkel aufgenommenen Videos, mit denen Dozenten ihre Studenten bis in deren Zuhause verfolgen. Was für eine ‹Häresie der Formlosigkeit› (Martin Mosebach)! Man mag sich nicht vorstellen, wie Hieronymus wohl aussähe, hätte ihn nicht Dürer gestochen, sondern eine qualitativ bescheidene webcam aufgenommen.
An dieser Stelle erweist sich, wie schon seit zwei Jahrtausenden, die katholische Kirche als wahre Beherrscherin medialer Formate. Von ihr wird zum einen an Traditionen angeknüpft, so etwa an das Pestkreuz von 1522: Papst Franziskus ist an einem Sonntagnachmittag zur Kirche San Marcello al Corso gewallfahrt, wo das Pestkreuz aufbewahrt wird, dessen Ankunft in Sankt Peter nach einer rund zweiwöchigen Prozession mit dem Ende der Pestepidemie zusammenfiel.

Auch der Fußweg war seinerseits bereits eine wirkmächtige Inszenierung, denn, wie Gustav Seibt, einer der besten Kenner Roms in Geschichte und Gegenwart, mutmaßte, muß es wohl viele Jahre vor 1870 gewesen sein, daß ein Papst zum letztenmal zu Fuß durch Rom ging. Wenn es nicht doch Pius XII. nach dem Luftangriff auf Rom im Zweiten Weltkrieg nochmals getan hat. Man könnte aber auch Johannes XXIII. ins Feld führen, der wegen seiner Romspaziergänge den Spitznamen ‹Johnnie Walker› trug. Zum anderen aber werden Traditionen auch neu erfunden. So hat der Papst in einer beispiellosen Zeremonie vor einem leeren Petersplatz den Segen Urbi et Orbi gespendet und damit in medialer Hinsicht eine Weltkirche performativ hergestellt, gerade indem sie physisch in Form der aus aller Welt stammenden Pilger nicht mehr anwesend war.

Wenn man daraus lernen wollte, müßte man Vorlesungen also nicht vor dem heimischen Bücherregal in Pantoffeln und mit dem regelmäßig atmenden, gelegentlich bellenden Fußwärmer, der nur von Ferne an Hieronymus’ Löwen erinnert, aufnehmen, sondern vor leeren Rängen eines Hörsaals in vollem Ornat. Dies ist angesichts der Zutrittsbeschränkungen vielerorts aber kaum mehr möglich und vor dem Hintergrund der dann ja doch beschränkten inszenatorischen Mittel (wobei der Inhalt ja auch einmal eine Kategorie war) vielleicht generell wenig ratsam, sodaß sich die schon in der Apostelgeschichte bei der Erzählung des Damaskuserlebnisses rezeptionsästhetisch motivierte Trennung von Vision und Audition empfiehlt. Der Student darf sich erschrecken beim Anblick der miesen technischen Gestaltung, aber die Botschaft, der dann volle Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, ist zu hören.
Damit führt ein Virus in Zeiten absoluter digitaler Aufrüstung zumindest das Format ‹Vorlesung› auf das zurück, was vor den bunten Bildern einmal und lange Zeit im Zentrum stand: Die menschliche Stimme mit ihrer ganz eigenen Medialität. Wann bekommen wir die Introduction à la science orale zu lesen?
Maximilian Benz lehrt und erforscht die Ältere deutsche Literaturgeschichte an der Universität Zürich.
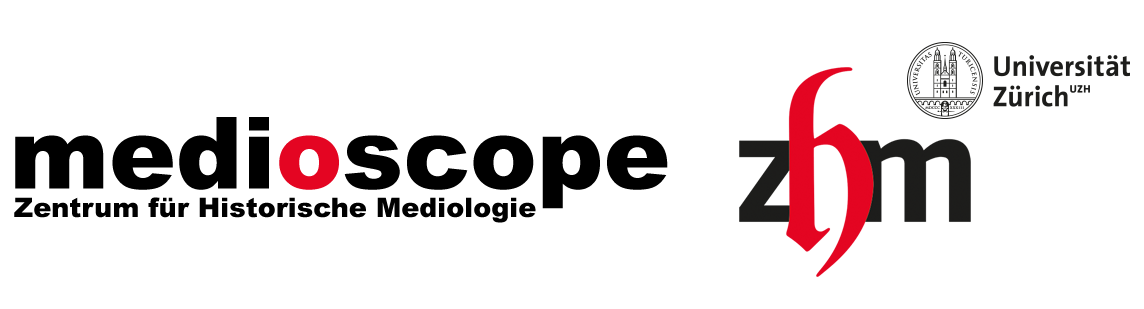

Vielen Dank für diesen anregenden Beitrag! Ich fühlte mich an solche Angebote von „The New Centre for Research & Practice“ erinnert, in der durch das ‚distance learning‘ manchmal unfreiwillig das Ganze zu persönlich werden kann, da man den Dozenten in seinem Wohnzimmer o.Ä. sieht. Daher bin ich Freund von der Funktion, dass man den Hintergrund bei der ‚webcam‘ unscharf stellen kann.
Liebe Frau Lanius, das ist ein wichtiger Punkt – daß hier eigentlich im Sinne wechselseitigen Respekts zu wahrende Grenzen eingerissen werden. Ich habe die genannte Funktion auch ausprobiert. Ich denke, es ist besser, dann doch ganz auf das Bild zu verzichten.