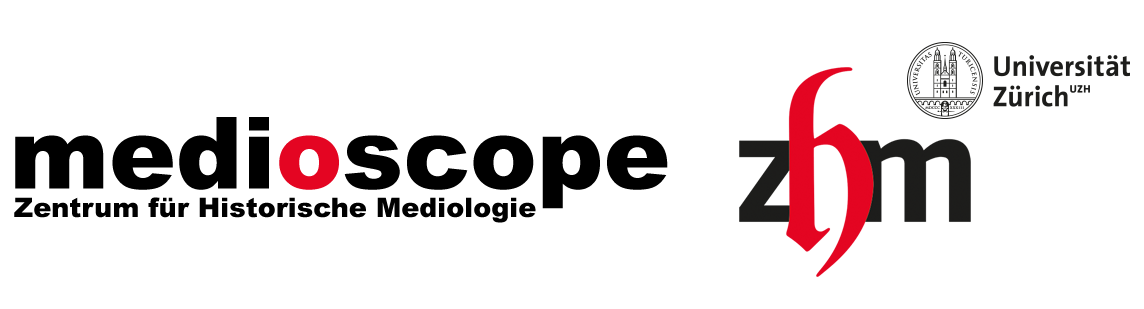Werkbundarchiv – Museum der Dinge
Ins Museum geht man, um Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht. Bei diesen Dingen handelt es sich vielfach um Artefakte, das heißt, absichtsvoll geschaffene Gegenstände, die über Vergangenheit und Gegenwart Auskunft geben und besonders, selten oder kostbar sind. Ausstellungsstücke legen Bezüge zu Epochen offen und machen Vernetzungen zwischen Künstlern und Kulturen sichtbar. Zuallererst stehen sie aber selbst als Objekte im Mittelpunkt, an denen sich Reflexionen über das Eigene und das Fremde, das Ästhetische und Schöne vollziehen.
Bei Museumsbesuchen geht es darum, Neues zu entdecken, Altes zu verstehen und Einblicke zu bekommen in Welten, die der eigenen enthoben sind. Der Besuch soll ein Erlebnis sein, das Aufmerksamkeit hervorruft und Kommunikation anregt. Dem „Warst du eigentlich schon in dieser Ausstellung?“ folgen Meinungsaustausch, Bewertung von Eindrücken und schließlich das wohlige Gefühl, Kultur nicht nur erlebt, sondern vor allem anderen davon berichtet zu haben.

Wie soll man aber mit einem Museum umgehen, das eben nicht das Besondere, das Wertvolle oder Kostbare ausstellt, sondern das Alltägliche, Gegenwärtige und gut Zugängliche in den Vordergrund rückt? Erfüllt dieses Museum überhaupt noch die üblichen Ansprüche? Wieso sollte man einen Ort besuchen, der sich eigentlich kaum von einer unaufgeräumten Wohnung unterscheidet und der deshalb auf den ersten Blick wenig Aufmerksamkeit erregt?
Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge in Berlin unternimmt genau dieses Experiment: Es trägt Alltags- und Gebrauchsgegenstände der vornehmlich deutschen Industriegesellschaft zusammen. Die Sammlung umfasst 35.000 Dokumente und 40.000 Objekte vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart; der Schwerpunkt liegt auf Gegenständen aus dem 20. Jahrhundert. Die Exponate werden in Glasschränken ausgestellt, ein Ordnungskonzept ist nicht zu erkennen.
Das Museum versteht sich als „zugleich gezieltes wie auch kontingentes Resultat einer ausstellungs- und forschungsorientierten Praxis“ (Link). Gezeigt wird, was in Gebrauch war und nun in einen musealen Kontext überführt wurde. So werden Dinge nicht nur aus den gewohnten Kontexten herausgehoben, sondern auch von Alltagsgegenständen zu Anschauungsobjekten stilisiert. Die Besucher sehen beim Gang durch die Dauerausstellung Gebrauchsgegenstände, die sie aus ihrem Alltag kennen.
Der Weg von Exponat zu Exponat – und damit auch durch die Jahrzehnte – wird nicht gekennzeichnet oder vorbereitet. Nebeneinander stehen Zinnfiguren, große Waschmitteltröge aus Pappmaschee, Geschirr der 1960er, 1970er und 1980er Jahre, bald schlicht, bald üppig, verziert mit farbintensiven Blumenmustern, Gießkannen in unterschiedlichen Formen und Farben, Telefone mit oder ohne Wählscheibe, Bügeleisen verschiedener Generationen, Plastikfiguren, Konserven aller Art, Spardosen und Küchenmaschinen, um nur einen Bruchteil der reichen Sammlung aufzuzählen. So weit, so unspektakulär.
Doch genau an diesem Punkt kommt der individuelle Faktor ins Spiel, der aus Beliebigkeit Aufmerksamkeit generiert und Präsenz schafft. In meinem Fall sind es kleine, bunte Haarspangen aus Plastik, die es vor wenigen Jahrzehnten paarweise zu kaufen gab. Gemacht, um dünnes Kinderhaar zusammenzubinden, am besten geeignet für zwei Zöpfe und schneller verloren als sie je in Benutzung waren. Die Ausstellung zeigt nicht nur ein Paar, sondern gleich zehn davon. Die Erinnerung zwingt mich innezuhalten, zu betrachten und zu kommunizieren: Vergangenes wird vergegenwärtigt und die Kindheit vor Augen gestellt. Der Fund ist im Chaos der Zusammenstellung überraschend und erzeugt dadurch umso größere Wirkung. Als Ausstellungsstück rufen die Haarspangen Staunen hervor. Das ist es, was das Museum der Dinge ausmacht: Alltägliches unaufgeregt als Besonderes auszustellen. Ein besonderer Raum wurde geschaffen, in dem aus Krimskrams Medien der Erinnerung gemacht werden. Die Besucher erarbeiten sich einen je individuellen Weg durch die Sammlung und lesen die Objekte auf ihre Art. Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge gibt keine Geschichten vor, sondern regt die Erinnerung an die eigene Geschichte an.

Beim Gang durch die Ausstellung handelt der Besucher immer wieder aufs Neue aus, welche Gegenstände für ihn wertvoll und bedeutsam sind. Die schiere Fülle davon erscheint bei der ersten Sichtung erdrückend. Die schlichte Aufreihung in Glasvitrinen erweckt einen musealen Eindruck, wirkt aber gleichzeitig befremdlich. Wie sonst kann man sich erklären, dass die eigentlich kostenlose Commerzbank-Werbefigur „Goldi“ hinter Glas steht und mit dem Slogan „Ist das ihr Ding“ dazu aufruft, eine „Dingpflegschaft“ (ab 30 Euro im Jahr) zu übernehmen? Der Wert der Pflegschaft übersteigt den Wert der Figur um ein Vielfaches.
Da die Objekte hinter Glas nicht mehr dem Gebrauch, sondern der Anschauung dienen, sieht man ihre Materialität und Form neu. Auch die „Auseinandersetzung mit Fragen der Vermarktung/Warenkultur, d.h. dem Labelling und Branding durch Marken, Firmenstrategien [und] Entwerfernamen“ (Link) tritt hervor. Geht es auf einer ersten Ebene um die eigene Geschichte, sind die Sammlungsobjekte auf einer zweiten Ebene auch immer Zeugen des gesellschaftlich-politischen und ökonomischen Wandels.
Was viele wegwerfen, wird im Museum der Dinge archiviert und als Ausstellungsstück präsentiert. Die Frage: „Ist das Kunst oder kann das weg“ stellt sich einmal mehr.
Werkbundarchiv – Museum der Dinge, Oranienstraße 25, D-10999 Berlin, Homepage Museum der Dinge
Pia Selmayr lehrt und forscht im Bereich der Älteren Deutschen Literaturwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität Zürich.