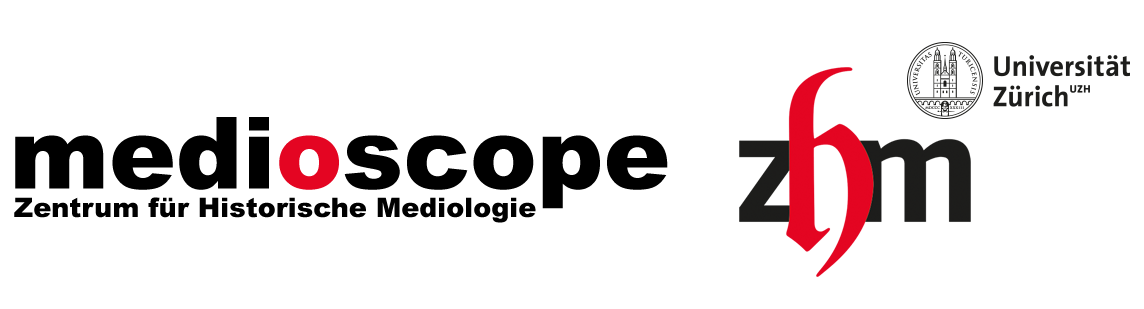Goethes Faust. Der Tragödie Erster Teil – ohne Sprache, in bewegten Bildern getanzt. Ihn neu zu erfinden und sich gleichzeitig in die Geschichte der medialen Bearbeitungen einzuschreiben, gelingt „Faust – Das Ballett“, das als Choreographie und Inszenierung von Edward Clug mit Musik von Milko Lazar in der letzten Spielzeit am Zürcher Opernhaus uraufgeführt wurde.
Im ikonischen Zeitalter des 21. Jahrhunderts erstaunt es nicht, dass der Aufmerksamkeitsschub rund um die Fabel vom Schwarzkünstler Dr. Heinrich Faust, der sich gerade so seltsam kontingent, aber durchaus stringent vollzieht, ganz im Zeichen der Bilder und Medien steht. Der Fokus gerät dabei weg von Goethes Sprache, man bezieht sich jedoch weiterhin auf dessen offensichtlich zum Archetypus gewordene Form des alten Stoffes. So zeigte bis zum Juli diesen Jahres, im Rahmen eines der Eventkultur frönenden Faust-Festivals, die Kunsthalle München eine Ausstellung mit dem Titel „Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst“, die neben ein bisschen Film- und Musikgeschichte vor allem die bildende Kunst ins Zentrum stellt und die, obwohl strikt dem Dramenplot folgend und als eigene Inszenierung auftretend, auf Goethes Sprache weitgehend verzichten kann. Auch das gerade erschienene Faust-Handbuch (hrsg. von Carsten Rohde, Thorsten Valk und Mathias Mayer bei Metzler), fokussiert neben den „Konstellationen“ und „Diskursen“ vor allem die „Medien“ – zumal es aus einem Projekt des Forschungsverbundes Marbach Weimar Wolfenbüttel hervorgeht, das den Faust-Stoff und seine Medialisierungen bearbeitet. Dieses Handbuch zeigt, wie sehr sich die beiden aktuellen Beispiele – Ballett und Ausstellung – in eine Stoffgeschichte einschreiben, die sich immer schon durch ihre äußerst vielfältigen Medialisierungen auszeichnete: Sie bewegte sich zwischen Puppentheater und Opernbühne, zwischen Zirkus und Nationaltheater, zwischen Postkarte und Salonmalerei, stets die Ebenen zwischen Hochkultur und Popularisierung verwischend.

© Gregory Batardon
Edward Clug, der die ewigen Themen des Faust-Stoffes anhand von Bulgakows Der Meister und Margarita inszenieren wollte, hat sich dann doch für Goethe entschieden, weil sie nun einmal in dieser Form in der Schweiz bekannt seien, wie er sich in der NZZ zitieren lässt: „Eine Geschichte, die mit Tanz erzählt werden soll, muss bereits im Gedächtnis der Zuschauer verwurzelt sein. Nur so kann man sie auch neu erzählen.“ Clug will mit dieser überdeutlichen Referenz auf Goethe, die – blickt man etwa auf Anne Imhoffs letztjährige Biennale-Performance mit dem Titel „Faust“ – gar nicht zwingend notwendig wäre, also auch an ihm gemessen werden. Und tatsächlich werden auf der Folie von Goethes Drama die klug gesetzten Fortschreibungen und Neuerfindungen lesbar. Aus dem subtilen Dialog mit ihm zieht die Inszenierung einen Großteil ihres Witzes, der bereits bei Goethe bei aller Verzweiflung und allem Hadern des sinnsuchenden Faust und bei aller Tragik der Margarete nie fehlt. Kongenial zu seinem Vorbild vermag Clug, den hohen Ton und die Groteske zusammenzubringen: Die bitterböse Ironie Mephistos, die bei Goethe immer wieder Fausts heuchlerischen Idealismus entlarvt, kann auch aus den Stillagen des Tanzes herausgelesen werden.

© Gregory Batardon
Den dem Medium des Ballettes eigenen Antinaturalismus nutzt Clug, um die Beziehungen zwischen Faust und Mephisto, Faust und Margarete in ebenso komischen wie sinn- und symbolreichen Bildern kristallisieren zu lassen. Dass Mephisto die Kehrseite von Faust – dessen nach Sinnlichkeit suchende verführbare Seite – ist und die Nachbarin Marthe Schwerdtlein die nach Außen projizierte Eitelkeit Gretchens, macht Clug in allen Schlüsselszenen deutlich. Ob im Duett zwischen Mephisto und Faust im Studierzimmer, einem gläsernen Inkubator, oder im Garten, wo Faust-Mephisto und Gretchen-Marthe im Doppelkostüm auftreten – der Pas de deux der Tänzerinnen und Tänzer arbeitet aus den von Goethes morphologisch gedachten Polaritäten eine Körpersprache der Spiegelungen heraus. Anders als in der Münchner Ausstellung, wo Spiegel die Ausstellungsarchitektur bestimmen, stehen die Spiegelungen hier nicht im Zeichen einer – schon vom Titel „Du bist Faust“ insinuierten – simplen Identifikation. Sie werden vielmehr eingesetzt zur Markierung von Differenz, zur Darstellung der das Hadern der Figuren bestimmenden Gleichzeitigkeit von Anziehung und Abstoßung als lebendig pulsierende, polare, doch komplementäre Prinzipien. Und ebenso im Gegensatz zur Münchner Ausstellung demonstriert das Ballett, dass eine Ausrichtung auf den ersten Teil von Goethes Drama nicht bedeuten muss, diesem mimetisch-illustrativ zu folgen.

© Gregory Batardon
Zwar hält sich die Inszenierung detailverliebt schon fast wörtlich nah an viele Goethe’sche Elemente, so haben etwa die zur Walpurgisnacht kriechenden Schnecken auch hier ihren großen Auftritt. Der inkubatorische Glaskubus ist sowohl Studierzimmer Fausts als auch Gefängnis Gretchens – wiederum Goethe entsprechend, der beide Räume von den Protagonisten als ihren „Kerker“ bezeichnen lässt. Und auch die Schmuckszene wird im Sinne Goethes keineswegs als rein dekoratives Element des Stücks begriffen. Die Inszenierung vermag in der visuellen Umsetzung die darin enthaltene Gewalt gar noch pointierend herauszustellen: Faust, der doch eigentlich weg vom Scheinhaften hin zur Wahrheit gelangen will, wendet die Waffe des trügerisch glänzenden Scheins auf Margarete an. In ihrem Tanz mit der verführerischen Perlenkette wird sie von ihr gehängt. Das Mal an ihrem Hals antizipiert ihre Enthauptung. Clug sieht und setzt sehr genau die Scharnierstellen in der Tragödie. Und trotz dieses Bewusstseins für die katastrophischen Konsequenzen ist diese Szene auch eine Feier der immer wieder zur Täuschung degradierten Mittel der Kunst und der Sinnlichkeit, und nicht von ungefähr schreibt sich Clug hier auch in die Tradition derjenigen bildenden Künstler ein, die sich bereits, wie in der Münchner Ausstellung schön zu sehen ist, im 19. Jahrhundert hingebungsvoll, produktiv und selbstbewusst mit dieser Verführung beschäftigt haben.
Vom Standpunkt der medialen Bearbeitung von Goethes Drama aus gesehen, sind auch die Abweichungen, die Clug vornimmt, von der Tradition vorgegeben: Das für Goethe auf der Theaterbühne Unsagbare bzw. nur symbolisch Sagbare – die Liebesnacht, die Schwangerschaft, der Kindsmord – wird von den Künstlern, die gerade dieses Nicht-Sagen Goethes als das eigentliche Skandalon empfunden haben, ausphantasiert und in der ganzen Brutalität gezeigt. Bei Clug gehen Schwangerschaftsübelkeit, Sich-Selbst-Ersticken und Kindsmord auf makaber-grotesk-komische Weise ineinander über. Man sieht ein vervielfachtes Gretchen sich über Eimer beugen, in die sie sich zu ertränken scheint, um dann den Inhalt über dem Kinderwagen auszuschütten.
Obwohl sich Clug also nah am Plot von Goethes erstem Teil bewegt, liest man den zweiten Teil stets mit, also dessen radikale Modernediagnose von den ungeheuren, die alte Ordnung auflösenden, sich verselbständigenden und zerstörerischen Kräften. Während die Ausstellung mit dem fadenscheinigen Argument, dass keine entsprechenden Werke existieren würden, den zweiten Teil auf ein kleines Verlegenheitskabinett mit drei Illustrationszyklen von Franz Staßen, Max Slevogt und Max Beckmann reduziert, zeigt Clug, wie es anders geht. Er entkleidet die Figuren noch mehr ihrer Individualität und konzentriert sich ganz auf die dem Medium des Tanzes angemessene Darstellung der aller Schranken enthobenen, dynamisierten Kräfte. Die „veloziferische“ Unruhe der faustischen Moderne kommt im rasanten Tempo dieser Körperbewegungen zur Entfaltung. Bereits durch das Bühnenbild, das gelbe und blaue Nebelschwaden zeigt, werden die „schwankende[n] Gestalten“ evoziert, die – „Ihr drängt euch zu! Nun gut, so mögt ihr walten / Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt“ – in Goethes Zueignung adressiert sind. In den ephemeren Körpergesten des Tanzes findet die Auflösung der Formen ihren Ausdruck. Es entstehen allegorische Bilderreihen, wie sie mehr als den ersten den zweiten Teil charakterisieren: In der Erzählung von Fausts Herkunft aus dem Kontext der Alchemie, die entsprechend ihres narratologischen Status als Rückblick am Bühnenrand silhouettenhaft aufscheint, ist schon die Homunculus-Szene mitzulesen, wie auch die Hexenküche, von aller gotisch-mystischen Atmosphäre beraubt, mit dieser Phantasie einer Erschaffung des künstlichen Menschen spielt. Diese wiederum gipfelt in der Walpurgisnacht, wo nach einem Aufzug von ebenso mythischen wie futuristischen Hybridwesen, auf dem gleichen metallisch-klinischen Seziertisch Faust in einem Reanimierungskuss der Hexe die letzte Menschlichkeit ausgesaugt wird. Die erotische Magie Goethes ist einer zwar ebenso barock-üppig-grotesken, aber letztlich nur noch brutalen, entindividualisierten Bedrohung gewichen. In diesem gläsernen Inkubator werden die Alpträume der Menschheit ausgebrütet.

© Gregory Batardon
Schon in Clugs Osterspaziergang erhält Faust nicht mehr das Versprechen einer erfüllenden Sinnlichkeit und eines lebendigen Naturzusammenhangs, sondern er wird sogleich in die Verstrickungen eines sexualisierten Gewaltzusammenhangs gezogen. Die pointierte Ausrichtung auf Polaritäten, die im Tanz der sich spiegelnden Protagonisten so überzeugend funktioniert, ist zugleich auch die Schwäche dieser Inszenierung. Wenn von der Schülerszene über den Osterspaziergang zur Hexenküche und Walpurgisnacht alle Szenen in ihrer Entmenschlichung, ihrem radikalen Synchronisierungswillen und der schneidenden Präzision der Bewegungen faschistoide Züge annehmen, dann wird dies alles über einen Kamm geschert. Auf der anderen Seite bleiben nur noch Faust und Gretchen als letzte Überbleibsel eines überkommenen Menschseins und als – in dieser Rolle vereinte – Opfer solch dämonischer Kräfte zurück. In der Schlussszene führt dies zu einer Umdeutung Fausts, dessen Rettungsversuch nicht mehr von Margaretes hellsichtigem Wahn als heuchlerische und herzenskalte Tat entlarvt wird, sondern sein Streben erscheint hier als dasjenige eines wahrhaft Liebenden und wird zum letzten Kampf für das Menschliche stilisiert. Wenn er, bevor er die Bühne verlässt, noch einmal rührselig die aus dem Inkubator herausragende Hand Gretchens streift, dann evoziert diese Abschiedsgeste noch einmal das Liebespathos des 19. Jahrhunderts, wie es sich sonst auf dieser Zürcher Opernbühne abspielt. Indem dabei jedoch viel zu schnell das Licht über Gretchen erlischt, wird deutlich gemacht, dass diese Stillage des heroischen Todes, in dem in langen Arien die Liebe erst richtig ihre Legitimation erhält, vorüber ist. Das Leben wird hier förmlich ausgeknipst.
Bei Goethe und um 1800 ist die Geschichte von Faust auch diejenige von der Entstehung des modernen autonomen Subjekts, das sich der dunklen Seiten, die in ihm selbst liegen – Mephisto kommt hier nur noch scheinbar von Außen –, bewusst wird. Heute hingegen erzählt Clugs Faust davon, dass dieses selbstbestimmte Individuum ganz von diesen aus seinem Inneren, im Pakt von Faust und Mephisto entfesselten, Kräften aufgezehrt wurde. Wie Faust II angedeutet und die vergangene Zukunft gezeigt hat, schlägt das nach Innen verlegte Böse von Außen wieder zurück.
Faust – Das Ballett. Uraufführung von Edward Clug. Musik von Milko Lazar. Nach «Faust. Der Tragödie Erster Teil» von Johann Wolfgang von Goethe. Choreografie und Inszenierung Edward Clug Musikalische Leitung Mikhail Agrest Komposition Milko Lazar Bühnenbild Marko Japelj Kostüme Leo Kulaš Lichtgestaltung Martin Gebhardt Video-Design Tieni Burkhalter Dramaturgie Edward Clug und Michael Küster
Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst. 23. Februar – 29. Juli 2018 in der Kunsthalle München in Kooperation mit der Klassik Stiftung Weimar. Kuratiert von Roger Diederen, Thorsten Valk, Nerina Santorius und Sophie Borges
Claudia Keller lehrt und forscht in der Neueren deutschen Literaturwissenschaft an der Universität Zürich.
Weiterer Beitrag: Mike Bill über die Münchner Faust-Ausstellung (unter „Besprechungen“)
Nächster Beitrag (15.11.): Medien abschaffen! (Marius Rimmele)