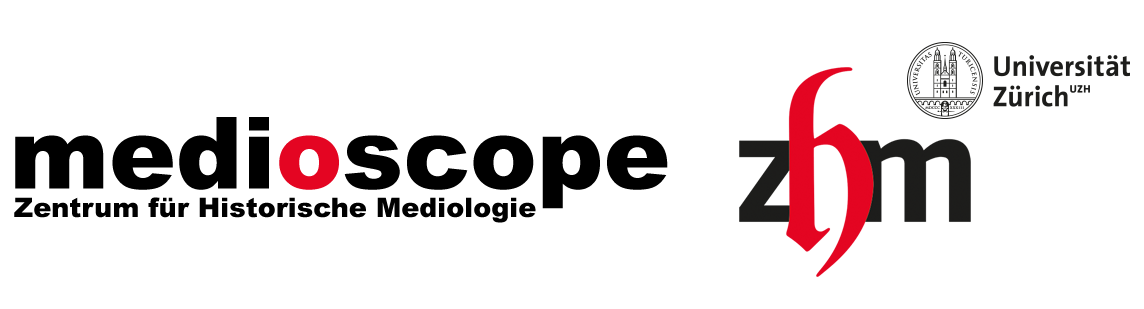Johannes Scheffler (1624–1677) oder Angelus Silesius (‚schlesischer Bote‘) ist der Verfasser eines „spekulativ-mystischen“ lyrischen Werks namens Geistreiche Sinn- und Schlussreime,[1] das fünf Bücher mit insgesamt über 1400 Epigrammen umfasst und 1657 erschienen ist.[2] Für den Rahmen dieses Beitrags und in Hinblick auf das Interesse am mystischen Potential als grenz- und möglichkeitsüberschreitender Rede soll die Betrachtung einer kleinen Auswahl in Form der Epigramme 1–20 des ersten Buchs genügen. Dafür spricht zum einen, dass man auch in der zweiten überarbeiteten Auflage der Gedichte des Barock an dieser repräsentativen Auswahl festhält,[3] und zum anderen lässt sich für deren thematisch-ästhetische Zusammengehörigkeit und bedingte Abgeschlossenheit argumentieren, was im Folgenden auch geschehen wird. Nun bleibt nur noch zu erwähnen, dass diese Betrachtung aus gegebenem Anlass und in Rückbezug auf die negative Theologie vom Kleinen (hier: sprachlich Pedantischen) zum Grossen der mystischen Wortgewalt und Gewaltigkeit selbst hinübergehen soll.
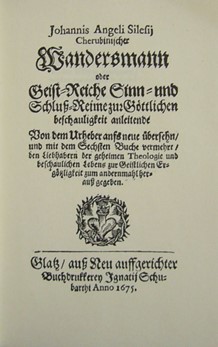
Der obige Reim im Titel aus dem 6. Epigramm von Angelus Silesius’ ‚mystischem Gedicht-Zyklus‘ mag nach standarddeutscher Konvention als nicht allzu rein erscheinen. Doch ist er unter den 20 Gedichten der einzige solcher Art, und selbst Martin Opitz als Begründer des deutschsprachigen Barock hält in seiner Poeterey das Schlesische beim Reimen mitunter für standarddeutsch.[4] Auch von diesem reizenden Detail abgesehen ist die Konformität mit Opitz’ Poetik allerdings gegeben,[5] wenn die zumeist zweizeiligen uniformen Einzelgedichte in paargereimten jambischen Alexandrinern von einfacher oder zweifacher Kadenz abgefasst sind. Den barocken Gepflogenheiten gleichfalls entsprechend ist in 2. Die Ewige Ruhestädt[6] nochein Vanitas-Motiv präsent, das die Hinwendung zu Gott bis in das Herz Jesu weiterführt: Es mag ein andrer sich umb sein Begräbniss kränken / Und seinen Madensak mit stoltzen Bau bedenken. / Ich sorge nicht dafür: Mein Grab / mein Felss und schrein / In dem ich ewig Ruh / sol’s Hertze Jesu seyn.
Mit der Überschrift 4. Man muss gantz Göttlich seyn[7]wird der mystische Einschlag dann aber mit voller Kraft forciert, nachdem die intendierte Leserschaft zu Beginn in der Form vertraulicher Unterweisung für eine sehr bestimmte Art der Rezeption vorbereitet worden ist: Rein wie dass feinste Goldt / steiff wie ein Felsenstein / Gantz lauter wie Crystall / sol dein Gemüthe seyn.[8]Die folgenden hyperbolisch anmutenden Aussagen zur menschlichen Göttlichkeit (z. B.: 8. GOtt lebt nicht ohne mich[9]) müssen dementsprechend auf eine reine Wahrnehmung treffen, die mit der spielerischen Bewegung zwischen Provokation und gleichzeitiger Entschärfung (z. B. zwischen Überschrift und dazugehörigem ‚Inhalt‘: 7. Man muss noch über GOtt. // […] Ich muss noch über GOtt in eine wüste ziehn.[10]) adäquat umzugehen vermag. Die für sich genommen vielleicht geradezu blasphemischen oder zumindest ketzerischen Anklänge sind durch die Epigramme drei und vier in das rechte Licht der unbändigen Begierde nach Gott gerückt, der allein vergnügen[11] bringen und dem man nur mehr als Göttlich[12] zu Genüge dienen könne.

Die Begierde kann denn auch als das zentrale Moment der Funktionsweise der Epigramme verstanden werden, insofern dieser Affekt das Ziel anzeigt und als auf Gott gerichteter reiner Affekt die am Anfang geforderte rezeptionstechnische Voraussetzung darstellt. Die Begierde und gegenseitige über alles gehende Liebe nämlich trägt auch Gott noch über sich hinaus: Wo GOtt mich über GOtt nicht solte wollen bringen / So will ich Ihn dazu mit blosser Liebe zwingen.[13] Das Ziel ist dabei die ewige Einheit noch vor der jenseitigen Ewigkeit: Ich selbst bin Ewigkeit / wann ich die Zeit verlasse / Und mich in GOtt / und GOtt in mich zusammen fasse.[14]
Die einzelnen Epigramme sind in ihrer Abfolge dabei teilweise konkret-begrifflich aufeinander aufbauend: 12. Man muss sich überschwenken. // Mensch wo du deinen Geist schwingst über Ort und Zeit / So kanstu jeden blik seyn in der Ewigkeit. /// 13. Der Mensch ist Ewigkeit.;[15] 19. Das seelige Stilleschweigen. // Wie seelig ist der Mensch / der weder will noch weiss! / Der GOtt (versteh mich recht) nicht gibet Lob noch Preiss. /// 20. Die Seeligkeit steht bey dir.[16] Die Gedichte 9–11[17] hingegen beziehen sich durch den Parallelismus chiastischer Titel von Verhältnissen zwischen dem ‚Ich‘ und ‚Gott‘ aufeinander und bilden so eine eigene Untereinheit in Kohärenz und Kohäsion. Das 20. Epigramm bezieht sich dann wiederum zurück auf den Anfang, da das dazwischen nur einmal zum Vorschein kommende initial menschliche ‚du‘ (Mensch wo du deinen […][18]) erneut auftritt, um eine an dieser Stelle letzte Unterweisung für den Weg zur Gotteinheit zu vernehmen: Mensch deine Seeligkeit kanstu dir selber nemen: / So du dich nur dazu wilt schiken und bequemen.[19]

Insgesamt bilden die 20 Epigramme (wenn auch einige möglicherweise, ohne grössere ästhetische Probleme aufzuwerfen, an eine andere, aber in Anbetracht sonstiger Zusammengehörigkeiten nicht völlig beliebige, Stelle verfrachtet werden könnten) eine von Vorbereitung zu provokativer Konfrontation und göttlichem Aufstieg übergehende Erfahrung. Dieser geleitete Aufstieg nimmt am ‚Ende‘ einen Appell-Charakter an, durch den eine Rückführung zur noch ungöttlichen Rezeptionsposition vonstattengeht, was diesen lyrischen Aufstieg als einen noch nicht zur unmittelbaren Gotteseinheit führenden markiert. Vielmehr ist der ‚reine Kristall‘ infolge der Lektüre dazu erleuchtet, den Weg zum Ziel aller und jenseits aller Begierde in Gott zu erkennen und zu beschreiten. Diese Erkenntnis wird dabei nicht dialektisch über eine stringente Argumentation gewonnen, sondern über die Form und den durch sie ausgelösten Affekt, also über die spezifische Ästhetik, die sich ganz der Rhetorik und einem lyrischen Gewicht kraftvoller Leichtigkeit verschreibt, das über prägnante Überbietung und pointierte Kürze funktioniert.
Dieser hier angetroffene lyrische Prozess, der die mystische Erfahrung als sprachlich spannungs- und gegensatzreiches Aufschwingen in Liebe zu Gott und in Gott hinein darstellt, lässt sich sowohl allgemein auf die zentrale Bedeutung des Wortes für die christliche Schrifttradition als auch konkret auf die negative Theologie des Pseudo-Dionysios-Areopagita beziehen, indem sich die Lyrik sprachlicher Bilder bedient, die eigentliche Bildlichkeit leugnen (Weg weg ihr Seraphim ihr könt mich nit erquikken / Weg weg ihr Heiligen / und was an euch thut blikken[20]) und durch paradoxe Hyperbolik (Ich bin so gross als GOtt: Er ist als ich so klein[21]) zugleich transzendieren können, um Bildlichkeit jenseits aller Bildlichkeit als ‚erleuchtende‘ Erfahrung fruchtbar zu machen.
Gott also gibt das Wort und bleibt im Inneren als höchstes Ziel. Derweil die Bilder ihn nicht fassen, ist das Wort, das nicht das Ding, vom Bild als Abbild frei. So kann das Wort in Bildern ohne Bild alleine vorwärtsgehen und den Gott im Herzen sehen. Sehen und Verstehen läuft indes nicht diskursiv, vielmehr durch einen Schlag des hellen Blitzes, ab. Den visionären Schlag kann dabei eine Lyrik, voll des Klanges steten Donnerns, alternierend wiederbringen. Diese muss dazu nur Gegensatz durch Reim in Einklang zwingen.
Abb. 2: Angelus Silesius, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Angelus_Silesius?uselang=de#/media/File:Silesius.png [Zugriff: 19.06.2024]
Abb. 3: Darstellung aus der Version der Geistreichen Sinn- und Schlussreime aus dem Jahr 1675, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Cherubinischer_Wandersmann.jpg [Zugriff: 19.06.2024]
[1] Johannes Scheffler: Geistreiche Sinn- und Schlussreime. In: Gedichte des Barock. Hrsg. von Ulrich Maché und Volker Meid. Stuttgart 1980, Zit. im Titel S. 199.
[2] Jan Mohr: Angelus Silesius. In: Verfasserlexikon – Frühe Neuzeit in Deutschland 1620–1720 1 (2019). Online via Verfasser-Datenbank: https://www.degruyter.com/database/VDBO/entry/vdbo.vl17.A32/html [Zurgiff: 19.06.2024].
[3] Volker Meid (Hg.): Gedichte des Barock. 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart 2014, S. 224–228.
[4] Martin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey. Hrsg. von Herbert Jaumann. Stuttgart 2002, S. 46 und Anmerkung dazu S. 157.
[5] Ebd., S. 53.
[6] Scheffler: Geistreiche Sinn- und Schlussreime (wie Anm. 1), S. 199.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Ebd., S. 200.
[10] Ebd.
[11] Ebd., S. 199.
[12] Ebd.
[13] Ebd., S. 201.
[14] Ebd., S. 200.
[15] Ebd.
[16] Ebd., S. 201.
[17] Ebd., S. 200
[18] Ebd.
[19] Ebd., S. 201.
[20] Ebd., S. 199.
[21] Ebd., S. 200.