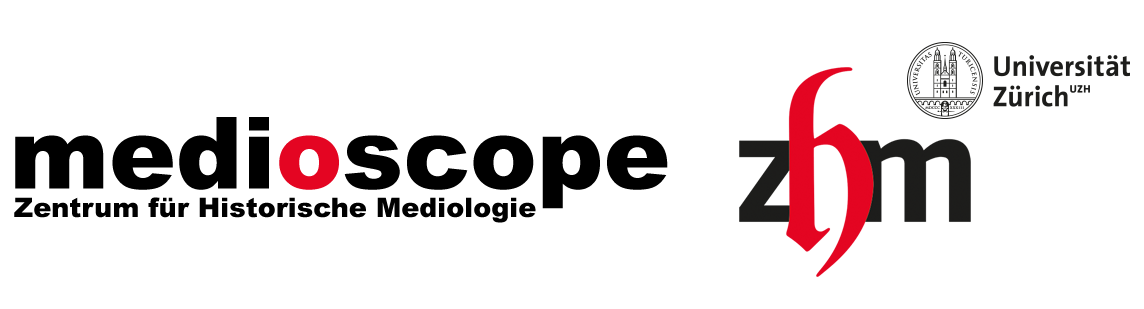Die Ausstellung „Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst“ in der Kunsthalle München hält der Gegenwart den Spiegel vor. Dass es dabei eher um eine schillernde Zurschaustellung simpler Identifikationsvorgänge statt der Möglichkeit zur individuellen Auseinandersetzung geht, wird unter den Teppich der reichhaltigen Rezeptionsgeschichte von Goethes Werk gekehrt.
Visuelle Spiegelung

Zwischen Odeonsplatz und Marienplatz befindet sich die Kunsthalle München an einem Knotenpunkt der Stadt. Die Ausstellungen, die hier dreimal jährlich durchgeführt werden, finden ihr Zuhause seit 2001 in einem Teil der „5 Höfe“, einer Kreation des Architektenduos Herzog & de Meuron. Der Ausstellungsort versinnbildlicht entsprechend die Verbindung einer prägnanten lokalen Platzierung mit einer global agierenden Architektur. Eine Gegenüberstellung, die im übertragenen Sinne auch in der derzeitigen Ausstellung „Du bist Faust“ zu beobachten ist: Goethes Tragödie Faust in seiner weltweiten, künstlerischen Weiterverarbeitung. Während das „bekannteste Werk der deutschen Literatur“, wie es in der Ankündigung der Ausstellung heißt, in dessen visuellen und auditiven Spiegelungen auf einer internationalen Ebene thematisiert wird, tritt der Stoff durch die Einbeziehung von Münchner Kulturinstitutionen (Kunsthalle München, Residenztheater, Staatsoper, etc.) regional verankert auf.
Die künstlerischen Arbeiten, die sich seit der Veröffentlichung von Goethes Faust I im Jahr 1808 – mal mehr, mal weniger explizit – auf die Handlung um den Doktor Faust beziehen, stehen dabei im Mittelpunkt dieser Ausstellung. Nebst der ersten Prämisse, der Handlung selbst einen Spiegel vorzuhalten, begegnet die Ausstellung durch die Wahl des Titels ihren Besucher*innen zudem mit einer zweiten Absicht und Aussage: „Du bist Faust“. Dass wir mit Faust nicht nur viel gemeinsam haben, sondern ihn vom Innersten bis zum Rand unserer eigenen Identität entdecken können, steht also außer Diskussion. Fragt sich nur, ob wir da auch mitdiskutieren dürfen?
Die Betrachtung des eigenen Selbst zieht sich durch die gesamte Ausstellung. Philipp Fürhofer, freischaffender Szenograf und Künstler, kleidet die Räume in dunkel kosmische und unschuldig weiße Farben, nutzt deren Symbolcharakter als Untergrund für die ausgestellten Arbeiten und deren Inszenierung. Der Spiegel fungiert als konstanter Begleiter – ob ganz glatt, zerbrochen oder lediglich als verspiegelte Lichtreflexionen in den Fenstern zwischen den Räumen: die Spiegelelemente werden als Hauptakteure inszeniert, und mit ihnen das darin Gespiegelte. Der gezeigte Handspiegel, den die Sopranistin Mari Carolin Miolan-Carvalho in der Uraufführung von Gounods Faust benutzte, wurde von ihren Anbetern als Kunstreliquie behandelt. Hier wird er auch zum Symbol des selbstversichernden Blicks, der sich auf uns Besucher*innen überträgt. Die Betrachtung des eigenen Körpers im Spiegel hat nämlich eher ein Haare-Zurechtrücken und Kleiderstück-Richten zur Folge; es mag das Narzisstische im Faust und damit ein heiß aktuelles Thema ansprechen, lässt eine Identifikation auf psychischer und menschlicher Ebene aber an der Oberfläche abblitzen und führt zu einem Assoziationszwang. Selbst-Reflexion wird zu einem leeren Symbol der Identifikation.

Mut zur Selbst-Reflexion
Das kuratorische Konzept suggeriert in der Umsetzung einen räumlichen Weg durch die Dramaturgie von Goethes erstem Teil der Tragödie. Eingangs der Ausstellung sind die Besucher*innen dazu eingeladen, die fiktive Figur Faust auf ihrer Suche nach Sinn zu begleiten. Anhand welcher Disziplin dies erfolgt, wird klugerweise nicht definiert. So ermöglicht sich das Kuratoren-Team eine breite Herangehensweise, die weder auf kunst- noch literaturhistorische Ansätze beschränkt wäre. Im Vordergrund stehen künstlerische Arbeiten, die den weltberühmten Stoff verarbeiten, in andere Medien um- und übersetzen. Die Vielzahl an Kunstwerken, die gezeigt werden, ist dennoch erfreulich. Wer diese Ausstellung besucht, wird reich beschenkt mit Medien aller Art und aus den verschiedensten europäischen Kontexten, die, sofern man liest, gut aufgearbeitet sind.
In der Kombination mit der theatralischen Raumgestaltung bringt die fehlende Klarheit im Ansatz in der Vermittlung dennoch einige Probleme mit sich: Künstlerische Kontexte wurden aufgearbeitet, finden in der Präsentationsweise aber keine Resonanz. So werden die Postkarten, eine Margarethe-Darstellerin zeigend, als voremanzipatorisch beschrieben und dennoch an eine rosarote Wand gehängt. Es wird Candida Höfers institutionskritische Arbeit Goethe Nationalmuseum Weimar III (2006) als solche erkannt, aber benutzt, um eine auratische Aufladung von Goethes Werk und seiner Person zu reproduzieren. Die Einschränkung auf eine Disziplin müsste nicht eine Verengung der ausgestellten Medien zur Folge haben. Vielmehr hülfe der Fokus auf eine Disziplin einem Ausstellungshaus, ihre Selbstreflexion kenntlich zu gestalten.

Unter dem Willen, möglichst viele Facetten zu präsentieren, leiden vor allem tiefgründige Details, deren Beleuchtung zu anderen Lesarten führen könnten. Eine Betonung darauf, dass die Aufführung von Gounods Oper Faust als Inaugurationsstück für die Metropolitan Opera in New York 1883 gedient hat, hätte – gerade im Sinne einer Rezeptionsgeschichte – die Verwendung der literarischen Materie als Start- und Anfangspunkt verdeutlicht. Dazu bestünden unzählige andere Verweise auf Theaterinszenierungen des (Ur-)Fausts, die besonders zu signifikanten Weichenstellungen der europäischen Geschichte, sei es die unmittelbare Nachkriegszeit, der Mauerfall oder die Jahrtausendwende, ihren Einzug in Theaterprogramme fanden. Könnte man daraus allenfalls Schlüsse ziehen, weshalb ein Faust-Festival gerade jetzt in Bayern zustande kommt?
Textliche Unschärfe
Wo es an einer reflektierten Ausstellungspraxis mangelt, wird mit materieller Hingabe gekontert. Die Räumlichkeiten sind außerordentlich sorgfältig ausgestaltet, die eingesetzten Materialien dezent verarbeitet. Der Anspruch, eine ebenso ansprechende wie faszinierende Ausstellung umzusetzen ist in dieser aufwändigen Produktion spürbar. Ebenso beeindruckend ist die Bildungsarbeit, die besonders im Rahmen dieses Projekts einen hohen Stellenwert einnimmt. Als Auseinandersetzung mit der Schullektüre schlechthin bietet diese Schau eine willkommene Abwechslung und Unterstützung bei der Lektürevermittlung. Dementsprechend groß ist der Andrang von Schulklassen, die sich, nacheinander, in die Reihe stellen, um einen bereitgelegten Audioguide zu fassen.
Verständlich, dass gerade in der Präsentation von durchgekauten und omnipräsenten Literaturstoffen des Schulalltags der Druck hoch ist, die Ausstellung für Lehrende und Lernende aufschlussreich zu gestalten. Letztlich ist es aber gerade die damit verbundene Scheu vor Langeweile seitens der Betrachter*innen, welche die Ausstellung in ihrer Chance, Goethes Faust originell zu setzen, hemmen. Die Anforderung an sich selbst, als Spiegel eines kompletten Faust-Festivals zu funktionieren, ist schlicht zu hoch angesetzt. Denn der Text, um den es hier geht, um den sämtliche ausgestellten Werke kreisen, wird dem Publikum vorenthalten. Im zweitletzten Raum stechen zwar scharf gesetzte Textpassagen, aufgedruckt auf den Tapetenwänden, aus einem unscharfen Textmeer auf. Dass dabei nicht nur die bekanntesten Teile des Textes scharfgestellt gezeigt, sondern zudem die übrige Textmasse zur Unkenntlichkeit unscharf dargestellt wird, reduziert den Text auf die gängigen Schlüsselpassagen und lässt die Komplexität von Goethes Sprache außen vor.

Entledigt man sich der Kopfhörer des Audioguides, bestechen die Räume durch eine dumpfe Stille, die, ab und an, über einige Ecken von Gounods Oper und fast flüsternden Kuratorinnen und Kunstvermittlerinnen beschallt werden. Was sich zunächst anfühlt wie sündhaftes Verhalten, eine respektlose Abkehr von den Bemühungen der Ausstellungsmacher, die einem bis eben noch über die Ohren mitgeteilt wurden, kippt sogleich in die Freude an einer eigenen Beobachtung: Die Kunsthalle zeigt nicht die Tragödie, sondern ein Spektakel.
Die Ausstellung „Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst“ war vom 23. Februar 2018 bis zum 29. Juli 2018 in der Kunsthalle München zu sehen.
Mike Bill studiert Kunstgeschiche (Hauptfach) und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft (Nebenfach) an der Universität Zürich.