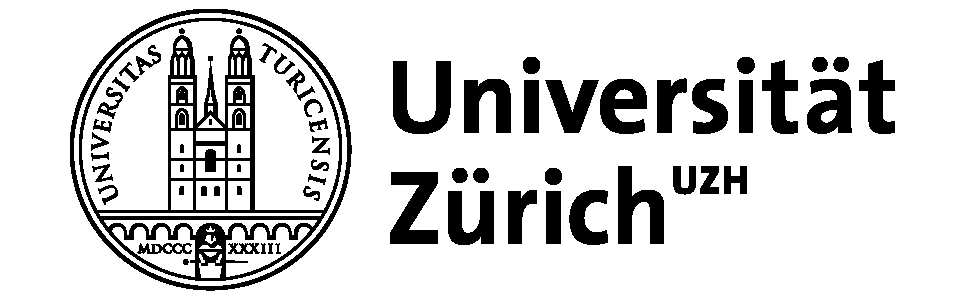New Speaker des Rätoromanischen in der deutschschweizerischen Diaspora – Erste Erkenntnisse zu ihrer Bedeutung für die Sprachweitergabe
Flurina Graf und Claudia Cathomas
Institut für Kulturforschung Graubünden
Abstract: An increasing number of Romansh speakers is living in the Swiss-German diaspora. An exploratory study by the Institute for Cultural Research Graubünden analyses their sociolinguistic situation. The role of new speakers who acquire Romansh through immersion or as adult learners has been little researched to date. Initial data indicate that subjectively perceived affiliation, self-assessed language competence and attitudes towards code-switching are decisive factors for language transmission. Positive childhood experiences and ideological motives drive parents to pass on the language to their children. However, linguistic insecurities and a tendency towards linguistic purism can prevent some parents from passing on the language. There is a need for further research, particularly with regard to the role of new speakers and parents with passive language skills in the maintenance of Romansh.
c
Keywords: New Speakers; language maintenance; Romansh; minority language; Code-Switching
1 Rätoromanisch in der Deutschschweiz – eine Bestandsaufnahme
Die Mehrheit der ca. 41’000 Rätoromaninnen und Rätoromanen lebt heute ausserhalb des rätoromanischen Sprachgebiets, in der sogenannten Diaspora rumantscha (Bundesamt für Statistik BFS 2021). Diese Bezeichnung wird sowohl von der Sprachgemeinschaft selbst als auch von Bund und Kanton verwendet. Die Strukturerhebung des Bundes zeigt zudem, dass mehr als zwei Drittel der rätoromanischsprachigen Kinder in Haushalten aufwachsen, in denen noch weitere Sprachen gesprochen werden, hauptsächlich Schweizerdeutsch (Roth 2019). Wie sich die Sprachweitergabe des Rätoromanischen an die nächste Generation in der Diaspora konkret gestaltet, ist aus den statistischen Daten nicht ableitbar und bisher auch noch nicht erforscht. Es ist aber davon auszugehen, dass diese für die Eltern eine Herausforderung darstellt, da sich der Sprachinput vorwiegend auf den Familienkreis und wenige weitere Kontakte beschränkt. Vor diesem Hintergrund situiert sich ein Forschungsprojekt des Instituts für Kulturforschung Graubünden, das die soziolinguistische Situation in der Deutschschweizer Diaspora rumantscha untersucht. Für diese explorative Studie wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt.
Mit der Abnahme von Sprechenden einer Minderheitensprache wächst in der Forschung zunehmend das Interesse an den sogenannten New Speakern und wie diese zum Spracherhalt beitragen können (Ó Murchadha et al. 2018). Die Definition des Begriffs wird breit diskutiert (vgl. Smith-Christmas et al. 2018). Wir stützen uns im Folgenden auf die Definition von O’Rourke, Pujolar & Ramallo (2015: 1). Demnach sind New Speaker «individuals with little or no home or community exposure to a minority language but who instead acquire it through immersion or bilingual educational programs, revitalization projects or as adult language learners». Ihre Bedeutung für die Weitergabe des Rätoromanischen wurde bisher noch nicht erforscht. Unsere explorative Studie, in der New Speaker nicht explizit Bestandteil des Samples waren, macht aber deutlich, dass eine intensivere Beschäftigung mit dieser Gruppe wichtig wäre. Wir unterscheiden zwischen New Speakern, die im Sprachgebiet aufgewachsen sind, zu Hause aber eine andere Sprache gesprochen haben und solchen, die nicht im Sprachgebiet aufgewachsen sind und Rätoromanisch im Erwachsenenalter gelernt haben.
2 Zugehörigkeit und Identität
Am Beispiel der New Speaker, die im rätoromanischen Sprachgebiet aufgewachsen sind, lässt sich die Bedeutung von subjektiv empfundener Zugehörigkeit und selbst eingeschätzter Sprachkompetenz für die Sprachweitergabe an die eigenen Kinder illustrieren. Die Erfahrungen in der Kindheit und Jugend können sich stark unterscheiden. Eine Person, die in einer deutschsprachigen Familie aufwuchs, berichtet von ihren Erfahrungen im Sprachgebiet:
Als Kind wirst du einfach von den Einheimischen gemobbt. Du gehörst nicht dazu, es wird dir immer unter die Nase gerieben, dass du keine Einheimische bist. “Du kannst gar nicht richtig Romanisch, du bist keine von uns.” […] Nachher im Lehrerseminar [im deutschsprachigen Chur] war das kein Thema mehr. Dort habe ich zu den Romanischen gehört. (Elternteil)
Dieses Zitat zeigt beispielhaft, wie sehr soziale und sprachliche Identität verknüpft sind und wie Identität besonders dann bewusst wird, wenn sie in Frage gestellt wird. Identität ist eine Positionierung im sozialen Raum durch sich selbst und durch die anderen (vgl. Hall 1990: 225). Die Alterität – also die Abgrenzung vom und die Ausgrenzung des Anderen – wird im vorliegenden Zitat mit den angeblich ungenügenden Sprachkenntnissen begründet. Sprachkenntnisse werden demnach als Indikator für die Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Einheimischen angeführt. Interessanterweise wird die hier zitierte Person ausserhalb des Sprachgebiets als Rätoromanischsprechende wahrgenommen und ihre Rätoromanischkompetenzen werden nicht bemängelt. Dort ist sie Teil der sich über die Sprache definierenden sozialen Gruppe, noch mehr, sie wird sogar ermuntert, das Rätoromanische zu pflegen, sei es in der Ausbildung oder in der Weitergabe an ihre Kinder. Dieses Beispiel zeigt die Fluidität und Kontextualität sozialer und sprachlicher Identitäten. Verschiedene Rätoromanischsprechende können deshalb zugleich als ähnlich oder als unterschiedlich wahrgenommen werden, was Hall (1990: 227) als «the “doubleness” of similarity and difference» bezeichnet. Aus einer weiteren Perspektive – der Deutschschweiz – sind sie eins, unabhängig ihres Idioms oder der Art des Spracherwerbs. Dementsprechend treten sie auch als Rätoromanischsprechende auf, um ihre Interessen zu vertreten. Von Nahem betrachtet treten Unterschiede stärker hervor. Die Sprechenden nehmen unterschiedliche Kategorisierungen vor, schliessen sich zu Gruppen desselben Idioms zusammen oder grenzen New Speaker aus. Ähnliches wird auch in anderen Minderheitensprachen beobachtet. New Speaker einer Minderheitensprache fühlen sich oft verunsichert und der Sprachgruppe nicht voll zugehörig oder nicht dazu legitimiert, die Sprache zu sprechen (vgl. Ortega et al. 2015; Ó Murchadha et al. 2018). Dies kann zum Verzicht der Sprachweitergabe führen (vgl. Ciriza 2019: 371).
Andererseits können positive Kindheitserfahrungen die Zugehörigkeit zur rätoromanischen Bevölkerung zu einer Selbstverständlichkeit machen und motivieren dadurch zur Sprachweitergabe trotz familiärer Sozialisierung auf Schweizerdeutsch.
[Ich spreche mit meinem Kind Rätoromanisch], weil ich nichts Anderes kenne. Ich bin in Scuol aufgewachsen, das ist für mich meine Heimat. Und ich finde es schade, diese Sprache, […] es hiess immer Aussterben und so. Wenn ich diese Sprache kann, warum das nicht auch weitergeben? Oder zumindest so ein wenig das Gehör dafür. […] Mir ist auch alles, was mit Engadin [zu tun hat], wichtig, das mitzugeben, auch Tradition, Brauchtum. Dass er weiss, was ist ein Chalandamarz. Und die Sprache gehört für mich dazu. (Elternteil)
Die Motivation für die Sprachweitergabe liegt hier – gleich wie bei den interviewten Muttersprachigen – in einer emotionalen Verbundenheit und dem damit verbundenen Wunsch, die Wurzeln und Traditionen weiterzugeben, sowie in der Stärkung der kulturellen Identität durch die Verwendung der Sprache (vgl. König 2014). Dazu kommt die ideologische Motivation, eine vom Aussterben bedrohte Sprache zu bewahren (vgl. De Houwer 1999; Riches & Curdt-Christiansen 2010; Schwartz 2010).
Die New Speaker, die Rätoromanisch im Erwachsenenalter lernten, taten dies vorwiegend ungesteuert. Sie werden von ihren rätoromanischsprachigen Partnerinnen bzw. Partnern mehrheitlich als sprachinteressiert und sprachbegabt beschrieben. Aus deren Äusserungen lässt sich vermuten, dass beim Entscheid, die Sprache zu lernen und auch anzuwenden, ideologische Motive eine Rolle spielten (vgl. Nandi et al. 2022), aber auch der Wunsch zur Integration in die Familie der Partnerin bzw. des Partners. Dies zeigen auch Studien zum Baskischen, Katalanischen und Irischen (Puigdevall et al. 2018). Gemeinsam ist diesen New Speakern eine positive Einstellung zum Sprachenlernen und zur Sprachverwendung.
Mein Mann ist eigentlich nicht romanischsprachig. Und dann hatte er plötzlich das Gefühl, dass wir in Chur wahrscheinlich etwas Mühe haben werden, das [mit dem Romanischsprechen] durchzuziehen. Unser Kind hat begonnen, mehr auf mich zu hören […]. Und dann hat er gemeint: “Wenn du es auf Romanisch sagst, dann sage ich es halt auch auf Romanisch”. Und dann hat er begonnen, mit den Kindern zu lernen. (Elternteil)
Diese Familie schafft zu Hause eine Sprachinsel, auf der sich die nicht-dominante Sprache als Familiensprache stärken kann. Unsere Daten lassen auch einen positiven Effekt von Elternteilen mit passiven Sprachkenntnissen vermuten. Denn auch diese ermöglichen eine rätoromanische Kommunikation der anderen Familienmitglieder, ohne dass dadurch jemand ausgeschlossen werden würde.
3 Code-Switching und die Einstellung zur Sprachmischung
Aufgrund der beschriebenen Dominanz des Schweizerdeutschen und Standarddeutschen als Umgebungssprachen ist auch die rätoromanische Sprache stark durch Einflüsse der deutschen Varietäten geprägt. Code-Switching, d.h. das gleichzeitige Verwenden mehrerer Sprachen innerhalb oder zwischen Sprachäusserungen (den Begriff prägte u.a. Auer 1999), ist ein in Sprachkontaktsituationen bekanntes Phänomen und kann im Fall von Minderheitensprachen sowohl Ausdruck von Sprachvitalität als auch von Sprachwandel sein (Gardner-Chloros 2020: 188). Studien zum Code-Switching bei in der Regel bilingualen Rätoromanischsprachigen zeigen, dass es sich hierbei oft um Einbettungen von Elementen aus dem Deutschen in die rätoromanische Satzstruktur handelt. Ganze Wechsel in eine andere Sprache, die für andere Sprachkontaktsituationen typisch sind, sind im Rätoromanischen seltener und oft auf isolierte Einwortäusserungen oder fixe Wendungen aus dem Deutschen beschränkt (vgl. Cathomas 2021), wie auch ein Beispiel aus den erhobenen Daten illustriert:
Igl o e da far cun ina certa Zueghörigkeit. Also eba, ni… (Elternteil)
(‘Es hat auch mit einer gewissen Zugehörigkeit zu tun. Also eben, oder…’)
Diese starke Präsenz des Deutschen in der rätoromanischen Alltagssprache erfüllt verschiedene Funktionen. Neben diskursiven und expressiven Funktionen ergibt sich in der spezifischen Situation von Minderheitensprachen verstärkt ein weiterer Grund für die Verwendung von Code-Switching: die Überbrückung von Wortfindungsschwierigkeiten (vgl. Zentella 1997). Diese Motivation für die Verwendung des Deutschen im Rätoromanischen ist bei allen Sprechenden weit verbreitet, könnte jedoch bei New Speakern eine noch bedeutendere Rolle spielen. Gerade bei Sprechenden, die ausserhalb des rätoromanischen Sprachgebiets wohnen und deren tägliche Interaktionen überwiegend auf Deutsch stattfinden, ist der deutsche Wortschatz oft grösser und differenzierter als der rätoromanische, weshalb er als lexikalische Stütze in Form von Insertionen dienen kann. Neben den individuellen Bedingungen für eine lexikalische Dominanz des Deutschen, wie zum Beispiel der Besuch von deutschsprachigen Schulen, kann diese Dominanz auch als eine strukturelle Eigenschaft des Rätoromanischen angesehen werden, da in verschiedenen Bereichen spezifische rätoromanische Lexik fehlt, wie das folgende Zitat einer Biologielehrperson des Gymnasiums illustriert.
Das Unterrichten in Romanisch ist noch recht schwierig, weil es gibt einfach viele Wörter nicht. […] Die Schüler nehmen dann Alltagswörter und übersetzen diese und dann stimmt es biologisch nicht. […] Dort komme ich jetzt ziemlich in einen Clinch, gebe ich ihnen ein deutsches Wort, dafür ist es das Fachvokabular, oder gebe ich ihnen ein romanisches Wort, das das deutsche Wort umschreibt, sie dann aber kein Fachvokabular haben. (Lehrperson)
Die Verwendung des Deutschen als lexikalische Ergänzung erweist sich als eine gängige Strategie, die auch dazu verhilft, nicht ganz ins Deutsche wechseln zu müssen. Dabei befinden sich diese Einschübe aus dem Deutschen in einem Kontinuum zwischen spontaner und integrierter Entlehnung und wirken im Gespräch entsprechend mehr oder weniger markiert. Diese Form von Code-Switching kann als markantes Charakteristikum der rätoromanischen Alltagssprache bezeichnet werden und ist nicht nur für New Speaker typisch.
Trotzdem fällt in den Interviews auf, dass gerade Eltern, die grossen Wert darauf legen, ihren Kindern einen differenzierten Wortschatz zu vermitteln, aber gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse als ungenügend einstufen, auf die Sprachweitergabe verzichten. Sie sehen die Sprachmischung als Bedrohung der Sprache. In ihrem Fall führt jedoch gerade diese Einstellung, gepaart mit Unsicherheiten in der Lexik, zur Sprachaufgabe:
Mein Hauptproblem war: Ich wollte ihm etwas zeigen und dann kommt Kran und Lastwagen und (atmet laut aus) “Quest un kran, quest un lastwaga.” Ja super, weisst du so camiun [‘Lastwagen’] kommt mir dann nachher schon, aber beim Betonmischer hört es dann schon auf und das sind halt Wörter, die ich sowieso nie gebraucht habe. Und dann kommt man so ins Stackeln und das finde ich einfach doof, wenn man vor einem Kind anfängt zu stackeln, weil einem die Wörter nicht in den Sinn kommen. (Elternteil)
Eine solche tendenziell sprachpuristische Haltung von New Speakern konnte auch in anderen Minderheitensprachen festgestellt werden, beispielsweise im Baskischen. Diese Haltung wird nicht zuletzt auch durch das Umfeld beeinflusst. So zeigt Lantto (2018), wie Code-Switching je nach Spracherwerbssituation unterschiedlich bewertet wird. Wird es von sogenannten Native Speakern praktiziert, wird dies als authentisches informelles Sprechen bezeichnet. Dieselbe Strategie wird bei im Sprachgebiet aufgewachsenen New Speakern jedoch als Ausdruck eines sprachlichen Defizits interpretiert. Dies führt laut Lantto (2018: 167) zu «purist tendencies in new Basque speakers’ code-switching patterns». Verbreitet ist auch die Sorge von New Speaker–Eltern, dass ihre Sprachverwendung zu wenig «natürlich» oder «authentisch» sei, weshalb sie auf die Sprachweitergabe verzichten (vgl. Lantto 2018, Ortega et al. 2015).
Wenn ich im Zoo einen Pfau sehe, dann möchte ich meinem Kind sagen können: “Oh schau, das ist ein Pfau” und wenn meine Freundin ihrem Kind sagt: “Oh guarda, quist es ün grond utschè” [Rumantsch Vallader: ‘Oh schau, das ist ein grosser Vogel’], dann stört mich das, genauso wie es mich stört, wenn Leute ihren Kindern sagen: “Oh, da kommt der Wauwau.” Ich finde es ganz wichtig, dass man von Beginn an schon ganz kleinen Kindern die richtigen Wörter lehrt. […] Lieber kein Romanisch als so ein halbes. (Elternteil).
Andererseits kann Code-Switching auf lexikalischer Ebene auch sprachfördernd wirken, weil damit ein kompletter Wechsel ins Deutsche verhindert wird. Eine erfolgreiche Sprachweitergabe hängt somit unter anderem auch von der elterlichen Einstellung zu Sprachmischungen und zu ihren Ansprüchen an die Qualität der Sprache ab.
4 Fazit
Unsere Untersuchung deutet auf eine noch wenig erkannte Bedeutung von New Speakern und Personen mit passiven Rätoromanischkenntnissen für die Sprachweitergabe hin. Im Kontext der stetig abnehmenden Sprechenden des Rätoromanischen kommt ihnen aber eine wichtige Rolle zuteil. Durch ihre Sprachkompetenzen kann der Sprachinput erhöht und der Sprachwechsel innerhalb einer Gruppe vermieden werden. Sprachrevitalisierung sollte demnach als gemeinschaftliches Unternehmen von Sprechenden mit unterschiedlichen Sprachkompetenzen verstanden werden (vgl. Ciriza 2019; Puigdevall et al. 2018). Dies bedingt jedoch eine Anerkennung von New Speakern als legitimierte Sprechende des Rätoromanischen innerhalb und ausserhalb des traditionellen Sprachgebiets.
Trotz zahlreicher Übereinstimmungen unserer Forschungsergebnisse mit jenen zu anderen Sprachminderheiten bestehen Wissenslücken zu verschiedenen Aspekten in Bezug auf die New Speaker im Rätoromanischen, etwa zum Einfluss des Umfelds und der Erwerbssituation auf die Motivation zur Sprachweitergabe sowie den Sprachpraktiken dieser Zielgruppe. Ebenso fehlen Untersuchungen zum Einfluss von Elternteilen mit passiven Rätoromanischkenntnissen auf die Familiensprache(n) sowie die Sprachweitergabe an die Kinder. Und schliesslich dauern die Diskussionen um die Bedeutung von Qualität, Quantität und Vielfalt des Sprachinputs auf den Spracherwerb an (vgl. u.a. Lanza & Lomeu Gomes 2020).
Bibliographie
Auer, Peter (1999). «From codeswitching via language mixing to fused lects: toward a dynamic typology of bilingual speech», International Journal of Bilingualism 3.4, 309-332.
Bundesamt für Statistik (2021). «Strukturerhebung. Hauptsprache nach Kanton, 2017-2021», in: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/grundlagen/volkszaehlung/vier-kernelemente/strukturerhebung.html> [08.03.2024].
Cathomas, Claudia (2021). «Ju a detg jeu fetsch bu il verstellen mei – Davart fuormas e funcziuns da code-switching el tuatschin», Annalas da la Societad Retorumantscha 134, 103-123.
Ciriza, María del Puy (2019). «Towards a parental muda for new Basque speakers: Assessing emotional factors and language ideologies», Journal of Sociolinguistics 23, 367-385.
De Houwer, Annick (1999). «Environmental factors in early bilingual development: The role of parental beliefs and attitudes», in: Extra, Guus & Ludo Verhoeven (Hrsg.), Bilingualism and migration, Berlin/New York, De Gruyter Mouton, 75-95.
Gardner-Chloros, Penelope (2020). «Contact and Code-Switching», in: Hickey, Raymond (Hrsg.), The Handbook of Language Contact, Hoboken (NJ), John Wiley & Sons, 181-189.
Hall, Stuart (1990). «Cultural identity and diaspora», in: Rutherford, Jonathan (Hrsg.), Identity, Community, Culture, Difference, London, Lawrence & Wishart, 222-237.
König, Katharina (2014). Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen, Berlin/Boston, De Gruyter.
Lantto, Hanna (2018). «New Basques and Code-Switching: Purist Tendencies, Social Pressures», in: Smith-Christmas, Cassie, Noel P. Ó Murchadha, Michael Hornsby & Máiréad Moriarty (Hrsg.), New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices, London, Palgrave Macmillan, 165-187.
Lanza, Elizabeth & Rafael Lomeu Gomes (2020). «Family language policy: Foundations, theoretical perspectives and critical approaches», in: Schalley, Andrea C. & Susana A. Eisenchlas (Hrsg.), Handbook of Home Language Maintenance and Development, Berlin/Boston, De Gruyter Mouton, 153-173.
Nandi, Anik, Ibon Manterola, Facundo Reyna-Muniain & Paula Kasares (2022). «Effective Family Language Policies and Intergenerational Transmission of Minority Languages: Parental Language Governance in Indigenous and Diasporic Contexts», in: Hornsby, Michael & Wilson McLeod (Hrsg.), Transmitting Minority Languages, Palgrave Studies in Minority Languages and Communities, Cham, Springer, 305-329.
Ó Murchadha, Noel P., Michael Hornsby, Cassie Smith-Christmas & Máiréad Moriarty (2018). «New Speakers, Familiar Concepts?», in: Smith-Christmas, Cassie, Noel P. Ó Murchadha, Michael Hornsby & Máiréad Moriarty (Hrsg.), New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices, London, Palgrave Macmillan, 1-22.
O’Rourke, Bernadette, Joan Pujolar & Fernando Ramallo (2015). «New speakers of minority languages: the challenging opportunity – Foreword», International Journal of the Sociology of the language 231, 1-20.
Ortega, Ane, Jacqueline Urla, Estibaliz Amorrortu, Jone Goirigolzarri & Belen Uranga (2015). «Linguistic identity among new speakers of Basque», International Journal of the Sociology of Language 231, 85-105.
Puigdevall, Maite, John Walsh, Estibaliz Amorrortu & Ane Ortega (2018). «“I’ll be one of them”: linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts», Journal of Multilingual and Multicultural Development 39 (5), 445-457.
Riches, Caroline & Xiao Lan Curdt-Christiansen (2010). «A tale of two Montreal communities: Parents’ perspectives on their children’s language and literacy development in a multilingual context», The Canadian Modern Language Review 66 (4), 525-555.
Roth, Maik (2019). «Die rätoromanische Sprachminderheit in der Schweiz», Demos 2, BFS Aktuell, 6-10.
Schwartz, Mila (2010). «Family language policy: Core issues of an emerging field», Applied Linguistics Review 1, 171-192.
Smith-Christmas, Cassie, Noel P. Ó Murchadha, Michael Hornsby & Máiréad Moriarty (Hrsg.) (2018). New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices, London, Palgrave Macmillan.
Zentella, Ana Celia (1997). Growing up bilingual: Puerto Rican children in New York, Oxford/Malden (MA), Blackwell.